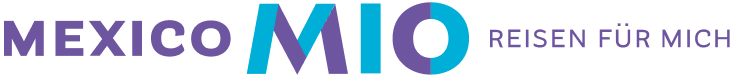35 Tage Mexiko – Ein Reisebericht von Michael Strauven
AUTORIN
Ireen
Ireen war eine langjährige Kollegin und Geschäftsführerin der MIO TOURS GmbH. Sie hat familiäre Bindungen in Mexiko und berichtete euch hier über Nachrichten aus ihrem Lieblingsland sowie eigene Reiseerfahrungen.
Mehr als einen Monat war die Familie Strauven Anfang 2013 mit uns in ganz Mexiko unterwegs. Mit einzigartigem Blickwinkel und unterhaltsamem Schreibstil führt uns Herr Strauven von Puerto Vallarta, über Oaxaca bis nach Tulum und vermittelt uns einen weitreichenden Einblick in die Lebensart Mexikos.
Puerto Vallarta – Oaxaca – Mexico City – Chiapa de Corzo – San Cristobal de las Casas – Campeche – Tulum
PUERTO VALLARTA
 Sehr langer Flug nach Puerto Vallarta (über Amsterdam/Mexiko-City), wir waren insgesamt 22 Stunden unterwegs, unbequem trotz KLM-Sondersitzen (Comfort-Economy je € 130.- extra). Dabei wäre alternativ ein Update auf Business-Class für je nur € 199.- im letzten Moment möglich gewesen, das stellt sich leider erst beim Online-Check-In heraus !!! Früher online einchecken !! Späte Ankunft, der Weg durch die kleine Stadt ist verstopft, gleich mexikanisches Streetlife, chaotisch, laut. Unser spezieller Transfer-Fahrer findet das Hotel nicht, ich ja, kenne (?) es bereits von Google Street View, so was hat Vorteile. Ankunft nach Mitternacht, die Wirtin Rita empfängt uns mit Fencheltee. Sie nennt sich Rita Love und zeigt gern Ihren Pass mit dem Namen, wenn man Zweifel andeutet. Eine mexikanisch aufgeputzte Amerikanerin, in die Jahre gekommene Schönheit, sehr reizend, sehr hilfreich, nervt fast ein wenig damit. 0:00 Uhr ist es vor Ort als wir endlich da sind, das ist 8:00 Uhr morgens bei uns im Kopf: Tiefstschlaf. Es bewährt sich, an 1. Tag nichts vorzuhaben.
Sehr langer Flug nach Puerto Vallarta (über Amsterdam/Mexiko-City), wir waren insgesamt 22 Stunden unterwegs, unbequem trotz KLM-Sondersitzen (Comfort-Economy je € 130.- extra). Dabei wäre alternativ ein Update auf Business-Class für je nur € 199.- im letzten Moment möglich gewesen, das stellt sich leider erst beim Online-Check-In heraus !!! Früher online einchecken !! Späte Ankunft, der Weg durch die kleine Stadt ist verstopft, gleich mexikanisches Streetlife, chaotisch, laut. Unser spezieller Transfer-Fahrer findet das Hotel nicht, ich ja, kenne (?) es bereits von Google Street View, so was hat Vorteile. Ankunft nach Mitternacht, die Wirtin Rita empfängt uns mit Fencheltee. Sie nennt sich Rita Love und zeigt gern Ihren Pass mit dem Namen, wenn man Zweifel andeutet. Eine mexikanisch aufgeputzte Amerikanerin, in die Jahre gekommene Schönheit, sehr reizend, sehr hilfreich, nervt fast ein wenig damit. 0:00 Uhr ist es vor Ort als wir endlich da sind, das ist 8:00 Uhr morgens bei uns im Kopf: Tiefstschlaf. Es bewährt sich, an 1. Tag nichts vorzuhaben.
Gemeinsames Frühstück aller Gäste (8), süße Pfannkuchen mit Bacon, Vanillesoße – das ist nicht mexikanisch, sondern US-amerikanisch. Interessierte New Yorker mit
am Tisch, unser Hotel ‚Casa Amorita‘ ist eine leicht bohémige Ami-Enklave.
 Dann erster Rundgang, schön lässige kleine Stadt am Pazifik, alles lustwandelt auf dem Malecon, auf der Uferpromenade. Wir sind die einzigen Deutschen weit und breit, sonst Ami-Rentner, es gibt auch betuchte Mexikaner, auch eine kaum übersehbare Schwulenzone. Nirgends ist es voll, die Saison ist vorbei, Low Season, ab 6.1. sind die Ferien in Mexiko und den USA vorüber, hier sind jetzt wenige, schon gar nicht aus Europa, nirgends ist es ausgebucht. (Vorher die lokalen Ferien am Zielort checken !) Und es ist absolut insektenfrei, weil Trockenzeit, ideal.
Dann erster Rundgang, schön lässige kleine Stadt am Pazifik, alles lustwandelt auf dem Malecon, auf der Uferpromenade. Wir sind die einzigen Deutschen weit und breit, sonst Ami-Rentner, es gibt auch betuchte Mexikaner, auch eine kaum übersehbare Schwulenzone. Nirgends ist es voll, die Saison ist vorbei, Low Season, ab 6.1. sind die Ferien in Mexiko und den USA vorüber, hier sind jetzt wenige, schon gar nicht aus Europa, nirgends ist es ausgebucht. (Vorher die lokalen Ferien am Zielort checken !) Und es ist absolut insektenfrei, weil Trockenzeit, ideal.
 20.000.- Peso gibt’s in der Bank auf die Hand gegen Visa-Card, nachdem die Geld-Automaten alle streiken und die Ami-Teenies davor verzweifeln. 20.000.- Peso, das sind fast 1200.- Euro und das Geld reicht lange (wir zahlen bar, immer). Taccos unter der Brücke kosten 8 Peso (50 Cent) das Stück, im schönen Seaview-Restaurant (Vitea) drei Fish-Tacos vom Pazifik-Fisch Mahimahi rund 90 Peso, erste Qualität. Abends aber wechselt dort die Speisekarte, dann gibt es fast nur noch fade Allerweltskost für die Touristen, die Amis verderben den Geschmack.
20.000.- Peso gibt’s in der Bank auf die Hand gegen Visa-Card, nachdem die Geld-Automaten alle streiken und die Ami-Teenies davor verzweifeln. 20.000.- Peso, das sind fast 1200.- Euro und das Geld reicht lange (wir zahlen bar, immer). Taccos unter der Brücke kosten 8 Peso (50 Cent) das Stück, im schönen Seaview-Restaurant (Vitea) drei Fish-Tacos vom Pazifik-Fisch Mahimahi rund 90 Peso, erste Qualität. Abends aber wechselt dort die Speisekarte, dann gibt es fast nur noch fade Allerweltskost für die Touristen, die Amis verderben den Geschmack.
 Unsere Casa Amorita ist eine schöne Villa ein paar Schritte oberhalb des Malecon, unten viel Lärm, rummelartiger Volksauftrieb am Abend, einmal Feuerwerk wegen eines neuen Piers, die Glocken oft sehr laut von der pittoresk nahen Kirche. Wir wohnen in einem Postkartenmotiv. Mittags viele Amis auf der schattigen Terrasse eines entspannten Fischrestaurants (Joe Jack’s Fish Shack). Abends ein unwirscher Macho-Kellner im angesagten In- Restaurant (Red Cabbage Café), man muss vor der Tür warten, wird dann gesetzt (wie einst in der DDR) obwohl der Laden fast leer ist. Der Kellner wird unfreundlich, als die Dame dem Herrn am Tisch widerspricht und anderes Wasser bestellt, er bringt das, was der Herr will (wenn der sich schon nicht durchsetzen kann, dann zeigt der Kellner der Dame eben was ein ganzer Kerl ist). Die Dame verschreckt, meine Erklärung will ihr gar nicht schmecken. (Das mit den unhöflichen Kellnern hört man öfter, ein mexikanischer Macho dient nicht gerne, außerdem allerorten Ermüdung, hier ist fast Saisonende.) Prompt schmeckt uns das Essen auch nicht, viel Soße, ‚Mole‘, das ist für Mexikaner ein seltenes und erstrebtes Highlight, für uns weniger, mehr dazu folgt.
Unsere Casa Amorita ist eine schöne Villa ein paar Schritte oberhalb des Malecon, unten viel Lärm, rummelartiger Volksauftrieb am Abend, einmal Feuerwerk wegen eines neuen Piers, die Glocken oft sehr laut von der pittoresk nahen Kirche. Wir wohnen in einem Postkartenmotiv. Mittags viele Amis auf der schattigen Terrasse eines entspannten Fischrestaurants (Joe Jack’s Fish Shack). Abends ein unwirscher Macho-Kellner im angesagten In- Restaurant (Red Cabbage Café), man muss vor der Tür warten, wird dann gesetzt (wie einst in der DDR) obwohl der Laden fast leer ist. Der Kellner wird unfreundlich, als die Dame dem Herrn am Tisch widerspricht und anderes Wasser bestellt, er bringt das, was der Herr will (wenn der sich schon nicht durchsetzen kann, dann zeigt der Kellner der Dame eben was ein ganzer Kerl ist). Die Dame verschreckt, meine Erklärung will ihr gar nicht schmecken. (Das mit den unhöflichen Kellnern hört man öfter, ein mexikanischer Macho dient nicht gerne, außerdem allerorten Ermüdung, hier ist fast Saisonende.) Prompt schmeckt uns das Essen auch nicht, viel Soße, ‚Mole‘, das ist für Mexikaner ein seltenes und erstrebtes Highlight, für uns weniger, mehr dazu folgt.
 Am nächsten Tag endlich Whale-Watching mit Oscar Frey (oceanfriendly tours), unser eigentlicher Anlass für Puerto Vallarta, Monate vorher nach erschöpfender Internet-Recherche zur Erkundung der Wal-Wahrscheinlichkeit gebucht. Oscar steht morgens um acht breitbeinig vor unserer Gruppe am Fischerhafen (10 Leute), er hat einige tiefe Narben im muskulösen Körper, Haifischbisse ? Keiner fragt. Oscar erzählt von den Liebesspielen der Wale und ist dabei ganz begeistert, ‚looking for a boy-friend‘, er malt die weltumfassenden Schwimmstrecken der Wale aus, die immer wieder hier enden, in der Bahia de Banderas, zum ‚Heiraten‘ wie er sagt. Was er meint wird gleich deutlich: In den Bäumen am Hafen liegen fast bewegungslos Leguane (Iguanas) von beachtlicher Größe in der Morgensonne, die Mädels kleiner und grün, die Jungs orange und groß (gut ein Meter lang). SIE klettert über IHN, der beißt im letzten Moment in ihren Schwanz, begeistertes Quieken, er besteigt sie um so den Erhalt der Art zu gewährleisten. Davor stehen Schilder der Stadtverwaltung: ‚endangered species‘, ‚vom Aussterben bedrohte Art‘.
Am nächsten Tag endlich Whale-Watching mit Oscar Frey (oceanfriendly tours), unser eigentlicher Anlass für Puerto Vallarta, Monate vorher nach erschöpfender Internet-Recherche zur Erkundung der Wal-Wahrscheinlichkeit gebucht. Oscar steht morgens um acht breitbeinig vor unserer Gruppe am Fischerhafen (10 Leute), er hat einige tiefe Narben im muskulösen Körper, Haifischbisse ? Keiner fragt. Oscar erzählt von den Liebesspielen der Wale und ist dabei ganz begeistert, ‚looking for a boy-friend‘, er malt die weltumfassenden Schwimmstrecken der Wale aus, die immer wieder hier enden, in der Bahia de Banderas, zum ‚Heiraten‘ wie er sagt. Was er meint wird gleich deutlich: In den Bäumen am Hafen liegen fast bewegungslos Leguane (Iguanas) von beachtlicher Größe in der Morgensonne, die Mädels kleiner und grün, die Jungs orange und groß (gut ein Meter lang). SIE klettert über IHN, der beißt im letzten Moment in ihren Schwanz, begeistertes Quieken, er besteigt sie um so den Erhalt der Art zu gewährleisten. Davor stehen Schilder der Stadtverwaltung: ‚endangered species‘, ‚vom Aussterben bedrohte Art‘.
 Das Whale Watching wird ein großer Erfolg, zum Glück, waren wir doch auch schon in Neuseeland (Südinsel) deswegen und das so gut wie vergeblich. Hier in dem sehr kleinen Boot kommen wir diesen Riesen ganz nah, wir riechen ihren tranig- vergammelten Atem, werden benetzt von ihrem nassen Prusten. Alles starrt minutenlang darauf mit offenen Mündern, das ist ja wie im Fernsehen, nur live, besser geht’s nicht. Rührung an Bord und ergriffenes Jubeln der Damen. Oscar knipst unaufhörlich und führt Buch, der Kapitän steuert das Boot mittendurch, stoisch und erhaben grinsend, mit schwarzem Schnauzer ein mexikanischer Seebär.
Das Whale Watching wird ein großer Erfolg, zum Glück, waren wir doch auch schon in Neuseeland (Südinsel) deswegen und das so gut wie vergeblich. Hier in dem sehr kleinen Boot kommen wir diesen Riesen ganz nah, wir riechen ihren tranig- vergammelten Atem, werden benetzt von ihrem nassen Prusten. Alles starrt minutenlang darauf mit offenen Mündern, das ist ja wie im Fernsehen, nur live, besser geht’s nicht. Rührung an Bord und ergriffenes Jubeln der Damen. Oscar knipst unaufhörlich und führt Buch, der Kapitän steuert das Boot mittendurch, stoisch und erhaben grinsend, mit schwarzem Schnauzer ein mexikanischer Seebär.  Alle acht Minuten tauchen die Biester auf, es werden immer mehr und doch hat man nie Angst um den winzigen Kahn. Wir betreiben hier Whale Watching in Realtime- Modus, einmal wird das abgesenkte Unterwasser-Mikrophon wieder eingeholt, heute singen die Wale nicht, in Neuseeland hatte man uns stattdessen ein Band vorgespielt. Lange geht das so, dann Imbiss und Bier auf hoher See. Einem dicken jungen Ami wird schlecht, seekrank, Kursänderung, hin zu den Vogelinseln näher an Land. Dort sind schon viele Boote, viele Schnorchler, offenbar flüchten viele vor der sachten aber beständigen Dünung weiter draußen. Auf dem Rückweg dann der Höhepunkt: eine Wal-Mutter mit Baby schwimmt nahe beim Land um das Kleine vor den Killerwalen, den Orcas zu schützen, die auf so was besonders Appetit haben. Nun ist selbst der Walexperte Oscar ergriffen, nur ‚once in a year‘ sei so was wahrscheinlich. Schon deshalb ist Puerto Vallarta im Winter ein Muss. Nur deshalb ?
Alle acht Minuten tauchen die Biester auf, es werden immer mehr und doch hat man nie Angst um den winzigen Kahn. Wir betreiben hier Whale Watching in Realtime- Modus, einmal wird das abgesenkte Unterwasser-Mikrophon wieder eingeholt, heute singen die Wale nicht, in Neuseeland hatte man uns stattdessen ein Band vorgespielt. Lange geht das so, dann Imbiss und Bier auf hoher See. Einem dicken jungen Ami wird schlecht, seekrank, Kursänderung, hin zu den Vogelinseln näher an Land. Dort sind schon viele Boote, viele Schnorchler, offenbar flüchten viele vor der sachten aber beständigen Dünung weiter draußen. Auf dem Rückweg dann der Höhepunkt: eine Wal-Mutter mit Baby schwimmt nahe beim Land um das Kleine vor den Killerwalen, den Orcas zu schützen, die auf so was besonders Appetit haben. Nun ist selbst der Walexperte Oscar ergriffen, nur ‚once in a year‘ sei so was wahrscheinlich. Schon deshalb ist Puerto Vallarta im Winter ein Muss. Nur deshalb ?
 Ein Stück nur übern Berg hinter dem Hotel stehen die ehemaligen Häuser von Liz Taylor und Richard Burton. Neuer Beton überwuchert die ehemals prachtvollen
Ein Stück nur übern Berg hinter dem Hotel stehen die ehemaligen Häuser von Liz Taylor und Richard Burton. Neuer Beton überwuchert die ehemals prachtvollen
Villen, nun ist der Bau gestoppt, etwas spät hat die Stadt sich besonnen. Vor den Häuser-Resten erboste Amerikaner, ‚these two made this place‘ – ‚ diese beiden haben den Ort erst zu dem gemacht was er ist‘. Wie kann man nur diese Häuser verkommen lassen ? Einer erzählt von dem Blumenmeer an der Pforte des einen Hauses nach Liz Taylors Tod. Von ihm erfahren wir auch, was es mit der kleinen nachgebauten Seufzer-Brücke auf sich hat, die die schmale Straße zwischen den beiden Villen überbrückt. Über die hätten die Beiden Begegnung gesucht aber immer nur Er zu Ihr. Nach den nicht seltenen Streitereien hat Sie einfach den Zugang gesperrt, dann musste er betteln dass er wieder rüber durfte, erfolglos war das nie. Sie habe sein Haus nicht betreten … So schwärmen die betagten Fans vor den zwei unscheinbaren Beton-Baustellen in einer Seitenstraße auf dem Hügel über der Stadt.
 In der Bucht, wo der Mythos begann mit dem Film ‚Die Nacht des Leguan‘ von John Huston, steht jetzt ein hässliches Großhotel, für 400 Peso (€ 24.-) darf man für einen Tag an den Strand davor und einen teuren Drink auf Liz und Richard nehmen. Die legendäre Strohhütte von John Huston dort existiert nicht mehr. Wir passieren das Ganze etwas außerhalb der Stadt mit dem Bus unterwegs zum Botanischen Garten. Autofahren in besiedelten Ecken ist in Mexiko fast unmöglich. Überall gibt es ‚Topes‘, das sind auf die Straßendecke betonierte Bodenschwellen zur Verlangsamung der Reisegeschwindigkeit. Da anders die Mexikaner nicht zu achtsamem Fahren bewegt werden können hat jeder Verständnis dafür, jeder aber leidet auch darunter. (Auf der stark befahrenen Überlandstrecke von Guadalajara nach Mexiko-Stadt soll es über 1100 Topes geben.) Die gefürchteten Busfahrer schreckt das kaum, sie kacheln einfach mit ungebremster Geschwindigkeit drüber weg. Die Kiste bebt.
In der Bucht, wo der Mythos begann mit dem Film ‚Die Nacht des Leguan‘ von John Huston, steht jetzt ein hässliches Großhotel, für 400 Peso (€ 24.-) darf man für einen Tag an den Strand davor und einen teuren Drink auf Liz und Richard nehmen. Die legendäre Strohhütte von John Huston dort existiert nicht mehr. Wir passieren das Ganze etwas außerhalb der Stadt mit dem Bus unterwegs zum Botanischen Garten. Autofahren in besiedelten Ecken ist in Mexiko fast unmöglich. Überall gibt es ‚Topes‘, das sind auf die Straßendecke betonierte Bodenschwellen zur Verlangsamung der Reisegeschwindigkeit. Da anders die Mexikaner nicht zu achtsamem Fahren bewegt werden können hat jeder Verständnis dafür, jeder aber leidet auch darunter. (Auf der stark befahrenen Überlandstrecke von Guadalajara nach Mexiko-Stadt soll es über 1100 Topes geben.) Die gefürchteten Busfahrer schreckt das kaum, sie kacheln einfach mit ungebremster Geschwindigkeit drüber weg. Die Kiste bebt.
Im Botanischen Garten ist heute (Sonntag) Spiritisten-Treffen, Wickelröcke, Dritte-
Welt-Mode überall und Handleserinnen mit Riesen-Ohrringen, wie es sich gehört. Der empfohlene Rundweg durch den Botanischen Garten ist ein nur halb begehbar gemachter Urwaldpfad, er stinkt nach Jaguar, sehen kann man keinen. Beim Essen auf der Holzterrasse des Haupthauses vor uns winzige Kolibris, stehen an den Blüten in der Luft. Auf dem Rückweg ein Harakiri-Busfahrer, ein mexikanischer Fahrgast bekreuzigt sich beim Einsteigen, wir steigen lieber aus. Zwischenstopp an einer schönen Bucht (Boca de Tomatlan).  Wir bleiben und schauen zu: ein Fischer nimmt große Fische aus, Pelikane betteln um den Abfall, Kinder toben im Wasser, hopsen von der Landebrücke ins Seichte. Man sitzt auf einer Sandbank mit einem Corona-Bier, die Füße bohren im warmen Sand, unendlich viele leere Bierflaschen werden weggeschleppt, ein schöner Sommer-Sonntag geht zu Ende.
Wir bleiben und schauen zu: ein Fischer nimmt große Fische aus, Pelikane betteln um den Abfall, Kinder toben im Wasser, hopsen von der Landebrücke ins Seichte. Man sitzt auf einer Sandbank mit einem Corona-Bier, die Füße bohren im warmen Sand, unendlich viele leere Bierflaschen werden weggeschleppt, ein schöner Sommer-Sonntag geht zu Ende.
Das war’s hier für uns, zum Bleiben keine Lust mehr, erst später lernen wir erstaunt, dass Puerto Vallarta fast der einzige Ort an der Pazifik-Küste Mexikos sein soll, in dem man von der Drogenmafia nichts zu spüren meint.
OAXACA
 Auf langem Umweg per Flug nah Oaxaca (wieder über Mexico-City). Spätabends mit dem Collectivo (Sammelbus) in die Stadt, an sehr belebten Geschäften vorbei zu Designhotel AZUL. Viel los auf den Straßen, die Autos trampeln schnell und laut übers antiquierte Kopfstein-Pflaster. Im Hotel herrscht scheinbar Ruhe, die deutsche Managerin erwartet uns. Leider sind die Zimmer nur zu belüften und zu belichten wenn Tür und Fenster offen stehen, aber im Innenhof wird es laut, wenn nur einer dort tätig ist, was fast immer der Fall ist (wie in so gut wie jedem Hotel in Mexiko).
Auf langem Umweg per Flug nah Oaxaca (wieder über Mexico-City). Spätabends mit dem Collectivo (Sammelbus) in die Stadt, an sehr belebten Geschäften vorbei zu Designhotel AZUL. Viel los auf den Straßen, die Autos trampeln schnell und laut übers antiquierte Kopfstein-Pflaster. Im Hotel herrscht scheinbar Ruhe, die deutsche Managerin erwartet uns. Leider sind die Zimmer nur zu belüften und zu belichten wenn Tür und Fenster offen stehen, aber im Innenhof wird es laut, wenn nur einer dort tätig ist, was fast immer der Fall ist (wie in so gut wie jedem Hotel in Mexiko).
 Erster Spaziergang die Alcala hinunter, Fußgängerzone, milde Luft, viele Leute unterwegs, gelassene Toscana-Atmosphäre, fliegende Händler hocken am Straßenrand, meist Indios, ruhen in sich, stören niemand. Am riesigen zentralen Platz, dem grün überwucherten Zocalo, nehmen wir Frozen Margherita. Touristen sehen wir nur wenige, es ist Montag, aber viele Mexikaner, abends, nachts beleben sich die Straßen. Ein alter, stark gehbehinderter Mann mit abgesägter Ventilposaune macht musikalisch gemeinten Lärm so bald die Marimba- und Mariachi-Spieler rundum mal Pause machen, dann schiebt er sich durch die Reihen der Caféhaus- Tische, er lächelt, jeder gibt was, der Mann tut was fürs Geld, das verschafft Achtung.
Erster Spaziergang die Alcala hinunter, Fußgängerzone, milde Luft, viele Leute unterwegs, gelassene Toscana-Atmosphäre, fliegende Händler hocken am Straßenrand, meist Indios, ruhen in sich, stören niemand. Am riesigen zentralen Platz, dem grün überwucherten Zocalo, nehmen wir Frozen Margherita. Touristen sehen wir nur wenige, es ist Montag, aber viele Mexikaner, abends, nachts beleben sich die Straßen. Ein alter, stark gehbehinderter Mann mit abgesägter Ventilposaune macht musikalisch gemeinten Lärm so bald die Marimba- und Mariachi-Spieler rundum mal Pause machen, dann schiebt er sich durch die Reihen der Caféhaus- Tische, er lächelt, jeder gibt was, der Mann tut was fürs Geld, das verschafft Achtung.
 Viel Musik von überall, aber auch unentwegt Indio-Kinder die mit unbrauchbarem Kleinkram hausieren kommen. Zwei alte Mexikaner vor uns, mit großen Hüten und Zigarren im Mundwinkel, verscheuchen die barsch, ich mache das nach und lerne von meiner Frau, das macht man nicht, schon gar nicht mit wegwerfender Handbewegung. Sie macht’s besser, sie quatscht die Kinder einfach voll, wenn sie einzeln und immer sehr direkt an den Tisch treten, in Deutsch und Englisch. Die setzen die sich dann, lauschen, antworten ebenso unverständlich fürs Gegenüber in Spanisch/Maya und ziehen dann freundlich winkend ab.
Viel Musik von überall, aber auch unentwegt Indio-Kinder die mit unbrauchbarem Kleinkram hausieren kommen. Zwei alte Mexikaner vor uns, mit großen Hüten und Zigarren im Mundwinkel, verscheuchen die barsch, ich mache das nach und lerne von meiner Frau, das macht man nicht, schon gar nicht mit wegwerfender Handbewegung. Sie macht’s besser, sie quatscht die Kinder einfach voll, wenn sie einzeln und immer sehr direkt an den Tisch treten, in Deutsch und Englisch. Die setzen die sich dann, lauschen, antworten ebenso unverständlich fürs Gegenüber in Spanisch/Maya und ziehen dann freundlich winkend ab.
 So nett ist es hier überall. Am nächsten Tag auf fast derselben Spazierstrecke zum Hauptplatz sehen wir neben dem alten Theaterbau, offenbar der Gand Opera Paris nachempfunden, ein erstes Beispiel für die mutige und schöne neue Architektur, die es in Mexiko öfter zu sehen gibt: das wunderbar modernisierte Convent San Pablo, ein um- und angebautes ehemaliges Kloster, jetzt Ausstellungsplatz, auch Bürohaus und Adresse zweier achtbarer Bistros. Wir tafeln im ersten Stock auf der modernistisch-minimalistisch möblierten Terrasse, mexikanisch selbstverständlich. Mole, Soße, die in weltweit gerühmten sieben Varianten hier in Oaxaca ’signature-food‘ ist, meiden wir, das lässt sich über den gesamten Aufenthalt nicht ganz durchhalten. Anderntags versperren Hundertschaften von Krankenschwestern dieselbe Ecke. Jahres-Hauptversammlung der Krankenschwester-Top-Organisation, man schubst, drängelt und kichert vor riesigen Tafeln mit hunderten von Porträtfotos, jede wurde hier abgelichtet, jede will alle Fotos sehen, jede will ihr Foto haben. Verkehrsbehinderung, niemand protestiert.
So nett ist es hier überall. Am nächsten Tag auf fast derselben Spazierstrecke zum Hauptplatz sehen wir neben dem alten Theaterbau, offenbar der Gand Opera Paris nachempfunden, ein erstes Beispiel für die mutige und schöne neue Architektur, die es in Mexiko öfter zu sehen gibt: das wunderbar modernisierte Convent San Pablo, ein um- und angebautes ehemaliges Kloster, jetzt Ausstellungsplatz, auch Bürohaus und Adresse zweier achtbarer Bistros. Wir tafeln im ersten Stock auf der modernistisch-minimalistisch möblierten Terrasse, mexikanisch selbstverständlich. Mole, Soße, die in weltweit gerühmten sieben Varianten hier in Oaxaca ’signature-food‘ ist, meiden wir, das lässt sich über den gesamten Aufenthalt nicht ganz durchhalten. Anderntags versperren Hundertschaften von Krankenschwestern dieselbe Ecke. Jahres-Hauptversammlung der Krankenschwester-Top-Organisation, man schubst, drängelt und kichert vor riesigen Tafeln mit hunderten von Porträtfotos, jede wurde hier abgelichtet, jede will alle Fotos sehen, jede will ihr Foto haben. Verkehrsbehinderung, niemand protestiert.
 Alles ist dann doch ertränkt in Mole im gelobten Toprestaurant (Casa Oaxaca), der vermeintlichen Spitzenküche der Stadt, Lieblingsrestaurant von Gabriel Garcia Marquez. Huhn mit Schokoladensoße, gar nicht süß, eher bitter-verbrannt, aber eben Soße im Übermaß. Qaxaca ist stolz auf seine sieben Moles, für Deutsche mit Gewöhnung an Einheitssoßen kein Genuss. Ansonsten heißt hier und fast überall in Mexiko exquisit essen fast immer: nicht mexikanisch essen. Das bedeutet weniger scharf aber immer auch mit starker Tendenz zum amerikanischen Einheitsgeschmack. Bald ist unser Lieblings-Restaurant (Pitiona – Cocina de Autor) oben beim Templo Santo Domingo. Großbürgerliche Villa, riesig hohe Räume, verfeinerte Küche mit winzigen Anklängen von Molekulartechnik: Mango als Schwabbel-Eigelb mit Glibberhaut auf Vanilleeis. Aber der Fisch – Red Snapper, das Fleisch – Short Rib vom Rind, alles bestens mexikanisiert, dazu Salsa Mexikana, Salsa Verde, Salsa Negro. Die scharfen Salsas gibt es ab jetzt immer, oft schon zum Frühstück.
Alles ist dann doch ertränkt in Mole im gelobten Toprestaurant (Casa Oaxaca), der vermeintlichen Spitzenküche der Stadt, Lieblingsrestaurant von Gabriel Garcia Marquez. Huhn mit Schokoladensoße, gar nicht süß, eher bitter-verbrannt, aber eben Soße im Übermaß. Qaxaca ist stolz auf seine sieben Moles, für Deutsche mit Gewöhnung an Einheitssoßen kein Genuss. Ansonsten heißt hier und fast überall in Mexiko exquisit essen fast immer: nicht mexikanisch essen. Das bedeutet weniger scharf aber immer auch mit starker Tendenz zum amerikanischen Einheitsgeschmack. Bald ist unser Lieblings-Restaurant (Pitiona – Cocina de Autor) oben beim Templo Santo Domingo. Großbürgerliche Villa, riesig hohe Räume, verfeinerte Küche mit winzigen Anklängen von Molekulartechnik: Mango als Schwabbel-Eigelb mit Glibberhaut auf Vanilleeis. Aber der Fisch – Red Snapper, das Fleisch – Short Rib vom Rind, alles bestens mexikanisiert, dazu Salsa Mexikana, Salsa Verde, Salsa Negro. Die scharfen Salsas gibt es ab jetzt immer, oft schon zum Frühstück.
 Kochkurs (Casa de los Sabores) mit Pilar Cabrera, die alles richtig macht und viel erklärt beim Gang durch die Markthalle des Viertels. Es gibt mindestens fünfzehn verschieden scharfe Sorten von Peperonis, viel unbekanntes Gemüse und überall Kakaobohnen, das Kilo 55.- Peso, das sind gut 3.- Euro. Deren Verarbeitung ist denkbar einfach, die gerösteten Bohnen kommen ganz (mit einer feinen silbrigen Haut) in eine Art riesige Kaffeemühle, wird mehrfach gemahlen und zunehmend mit Zucker versetzt, oder mit Chili, Salz, Zimt, Vanille … Eine körnige Paste kommt dabei heraus, kein Vergleich zu der feinen Schokolade, die wir kennen. Schmeckt anders – und wirkt auch anders.
Kochkurs (Casa de los Sabores) mit Pilar Cabrera, die alles richtig macht und viel erklärt beim Gang durch die Markthalle des Viertels. Es gibt mindestens fünfzehn verschieden scharfe Sorten von Peperonis, viel unbekanntes Gemüse und überall Kakaobohnen, das Kilo 55.- Peso, das sind gut 3.- Euro. Deren Verarbeitung ist denkbar einfach, die gerösteten Bohnen kommen ganz (mit einer feinen silbrigen Haut) in eine Art riesige Kaffeemühle, wird mehrfach gemahlen und zunehmend mit Zucker versetzt, oder mit Chili, Salz, Zimt, Vanille … Eine körnige Paste kommt dabei heraus, kein Vergleich zu der feinen Schokolade, die wir kennen. Schmeckt anders – und wirkt auch anders.  Die Mayas sollen davon im Übermaß genossen haben bevor sie tranceartig zu fast jeder Art von Gottesopfer bereit waren. Kakao in dieser Form ‚turnt‘, wir kosten davon – jeder ein, zwei ganze Kakaobohnen – und können die ganze Nacht nicht schlafen.
Die Mayas sollen davon im Übermaß genossen haben bevor sie tranceartig zu fast jeder Art von Gottesopfer bereit waren. Kakao in dieser Form ‚turnt‘, wir kosten davon – jeder ein, zwei ganze Kakaobohnen – und können die ganze Nacht nicht schlafen.
Nach dem Rundgang folgt der Kochkurs praktisch mit aufgeregten Ami-Muttis, die vieles besser wissen und übermotiviert alles mitschreiben, mit jovialen Ami-Pappis, die geduldig schnippeln, alle mit Kinderschürzen um einen großen Herd.  Das macht Spaß, es wird offenbar höchst ausgefuchst präpariert und gewürzt – nur das Ergebnis, nach Darreichung von Mezcal in mehreren Variationen gemeinsam verspeist, schmeckt langweilig. Dazu der Aufwand, das Brutzeln und Rösten, das Würzen und Wichtigtun ? Auch hier also siegt der Amigeschmack.
Das macht Spaß, es wird offenbar höchst ausgefuchst präpariert und gewürzt – nur das Ergebnis, nach Darreichung von Mezcal in mehreren Variationen gemeinsam verspeist, schmeckt langweilig. Dazu der Aufwand, das Brutzeln und Rösten, das Würzen und Wichtigtun ? Auch hier also siegt der Amigeschmack.
Die große Markthalle von Qaxaca besuchen wir oft – ein Erlebnis. Wie die Fleischer da zärtlich mit halben Schweineköpfen spielen, die Fischhändler mit den halbierten Riesen-Tunfischen, und das alles für unsere Kamera, das ist lustig und ein Bisschen gruselig. Stimmt das doch mit dem allgegenwärtigen Todeskult der Mexikaner ? Berührungsängste mit dem Sensenmann haben sie offenbar kaum.  Hier gibt es alles, was man essen kann und die kleinen gerösteten Insekten, Heuschrecken, Chapulines, die zu kosten wir ununterbrochen aufgefordert werden, sollen Glück bringen – so wie anderswo eine Münze im Brunnen. Das Größte aber und bald Zentrum unseres Interesses ist der kleine abgetrennte Bereich, in dem man frisch kocht und das vor Ort verspeist. Undurchdringlicher nebelartiger Rauch weht durch die Gänge, von den vielen Grillständen, an denen das immer Gleiche gegrillt wird: papierdünne Fleischlappen, verschieden scharf gewürzt, dann kombiniert mit gegrilltem Gemüse.
Hier gibt es alles, was man essen kann und die kleinen gerösteten Insekten, Heuschrecken, Chapulines, die zu kosten wir ununterbrochen aufgefordert werden, sollen Glück bringen – so wie anderswo eine Münze im Brunnen. Das Größte aber und bald Zentrum unseres Interesses ist der kleine abgetrennte Bereich, in dem man frisch kocht und das vor Ort verspeist. Undurchdringlicher nebelartiger Rauch weht durch die Gänge, von den vielen Grillständen, an denen das immer Gleiche gegrillt wird: papierdünne Fleischlappen, verschieden scharf gewürzt, dann kombiniert mit gegrilltem Gemüse.  Alles isst mit den Händen von Papptellern, alles schmeckt, nie auch nur ein Anflug von Ekel, hier ist es sauber.
Alles isst mit den Händen von Papptellern, alles schmeckt, nie auch nur ein Anflug von Ekel, hier ist es sauber.
Die Kirchen sind überladen mit Gold und Prunk (immer gibt es auch weißhäutige lebensgroße Holzfiguren, die die ersten europäischen Missionare darstellen sollen). In den vielen Läden mit Tand, Plastikspielzeug, Nylonkleidchen, Gesichtsmasken in Leuchtfarben und Folklore-Murks sehen wir zunehmend Totenköpfe, Skeletthemden, so was. Auch auf Mezcal-Flaschen findet sich hier und da ungeniert ein Totenkopf, daraus würde zu Hause niemand trinken. Mezcal hat mit dem berüchtigten Mescalin aus dem halluzinogenen Peyote-Pilz nichts zu tun, Mezcal heißt (wörtlich) Schnaps, Tequila ist einer davon, gewonnen alle aus Agaven. (Die bei uns übliche tote Made in der Mezcal-Flasche sieht man hier nicht, die gilt als Folklore-Gag.)
 Mexiko ohne die Maya-Ruinen ist undenkbar, das glauben wir erst einmal. Hoch zum Monte Alban für ein paar Peso. Auf dem Monte Albàn, da war die Hauptstadt und das religiöse Zentrum der Zapoteken (?) vor gut 15 Jahrhunderten. Heute ist das ein riesiges langweiliges Ruinenfeld auf 2000 mtr. Höhe. Wir stöbern herum, fast ohne Erkenntnisgewinn, heiß ist es, leergeräumt und mühsam. Uns graut vor den vielen Pflichtruinen hier in Mexiko, wir werden denen ausweichen, das planen wir sofort und das schaffen wir dann doch nicht.
Mexiko ohne die Maya-Ruinen ist undenkbar, das glauben wir erst einmal. Hoch zum Monte Alban für ein paar Peso. Auf dem Monte Albàn, da war die Hauptstadt und das religiöse Zentrum der Zapoteken (?) vor gut 15 Jahrhunderten. Heute ist das ein riesiges langweiliges Ruinenfeld auf 2000 mtr. Höhe. Wir stöbern herum, fast ohne Erkenntnisgewinn, heiß ist es, leergeräumt und mühsam. Uns graut vor den vielen Pflichtruinen hier in Mexiko, wir werden denen ausweichen, das planen wir sofort und das schaffen wir dann doch nicht.
Am nächsten Tag Rundfahrt mit Führer: ein Provinz-Tiermarkt, auf dem unverhohlen Pornohefte verkauft werden, was wir aber nicht fotografieren dürfen.
Daneben Ziege, Pferde, Ochsen und riesige Büschel Futterheu. Dann ein verlassenes halb zerstörtes Convento, Jesuitenkloster – Achtung den Brunnenrand nicht anfassen, den scheißen da im Gewölbe die Fledermäuse voll, das ist giftig ! Schließlich eine Malerwerkstatt zur Dekoration der unsäglich kitschigen mexikanischen Holztierchen, eine erschlagende Pracht von beherzter Farbigkeit. Aber alles wird überschattet von der hysterisch erregt vorgetragenen Geschichte einer mitfahrenden Französin aus Toronto, die sich am Vorabend auf Empfehlung ihres Hotels eine Massage gegönnt hat und dann fast umkam vor Scham und wohl auch Ekel, weil der Masseur ein gut behaarter mexikanischer Muskelmann war.
 Dann aber wollen wir’s wissen und selbst in die Hand nehmen: Wochenend-Markt im Indianerdorf gut 30 Kilometer entfernt – hin mit Taxi 215 Peso zurück im Collectivo, gelehnt an wohlgelaunte Dorfbewohner, alle verschwitzt, 80 Peso. Der Markt von Tlacolula de Matamoros ist unglaublich, wir mit unserer Sucht, möglichst Exotisches, Fremdes zu sehen sind hin und weg. Wir haben Hemmungen zu Fotografieren, die Stories von den Indios, die ihr Abbild nicht weggeben wollen, ist aber eine freundliche Übertreibung der Reiselektüre. Hier sind alle reizend und oft aufgekratzt nett, posieren für die Kamera, nur Kinder sind manchmal erschrocken über die fremdländischen Riesen, hier sind alle gefühlte ein Meter vierzig groß.
Dann aber wollen wir’s wissen und selbst in die Hand nehmen: Wochenend-Markt im Indianerdorf gut 30 Kilometer entfernt – hin mit Taxi 215 Peso zurück im Collectivo, gelehnt an wohlgelaunte Dorfbewohner, alle verschwitzt, 80 Peso. Der Markt von Tlacolula de Matamoros ist unglaublich, wir mit unserer Sucht, möglichst Exotisches, Fremdes zu sehen sind hin und weg. Wir haben Hemmungen zu Fotografieren, die Stories von den Indios, die ihr Abbild nicht weggeben wollen, ist aber eine freundliche Übertreibung der Reiselektüre. Hier sind alle reizend und oft aufgekratzt nett, posieren für die Kamera, nur Kinder sind manchmal erschrocken über die fremdländischen Riesen, hier sind alle gefühlte ein Meter vierzig groß.
Ein Huhn gegrillt mit Salat 100 Peso, d.h. 6 Euro – aber was für Hühner, Massentierhaltung wäre hier zu teuer, Hühner laufen überall herum und so sehen sie aus, auch auf dem Grill: stattlich, muskulös, fast fettfrei, ein Genuss. Schritt für Schritt überwinden wir unsere (angelesene) Abscheu gegen Streetfood und sonstige kulinarische Wagnisse, wir essen alles überall und haben nie Verdauungsprobleme. Die einzige Küchenschabe, Cucaracha, der Reise ist schon Wochen tot und liegt ausgetrocknet auf dem Rücken in der Gosse. Der Preis der Sauberkeit ?? Wenn man vormittags durch die Städte geht, oder abends kurz vor Ladenschluss, ist der Geruch von Desinfizierungs-Putzmitteln allgegenwärtig. Sauber, die Mexikaner.
 Mittwoch abends stehen lange Reihen von Wartenden alt und jung am Zocalo, dem Hauptplatz, geduldig aneinander gereiht, worauf warten die ? Auf Parkbänken verteilt überall Musiker, auch die warten, ein großes Orchester. Dann, mit der Dämmerung fährt ein Truck rückwärts auf den Platz, und einer nach dem Anderen der Wartenden holt sich einen Stuhl vom LKW, man gruppiert sich im weiten Kreis unter dem größten Baum gegenüber der prächtigen Kathedrale, das Orchester nimmt Platz. ‚Danzon‘, freier Tanzabend für alle – wie an jedem Mittwoch – den Anfang machen die fein gemachten Rentner, weißes Hemd, Schlips, meist Hut obendrauf, auch Weste und feine Bauchbinde, die Damen heftig geschminkt, in sehr bunten Kleidern, oft mit Spitzenhandschuhen.
Mittwoch abends stehen lange Reihen von Wartenden alt und jung am Zocalo, dem Hauptplatz, geduldig aneinander gereiht, worauf warten die ? Auf Parkbänken verteilt überall Musiker, auch die warten, ein großes Orchester. Dann, mit der Dämmerung fährt ein Truck rückwärts auf den Platz, und einer nach dem Anderen der Wartenden holt sich einen Stuhl vom LKW, man gruppiert sich im weiten Kreis unter dem größten Baum gegenüber der prächtigen Kathedrale, das Orchester nimmt Platz. ‚Danzon‘, freier Tanzabend für alle – wie an jedem Mittwoch – den Anfang machen die fein gemachten Rentner, weißes Hemd, Schlips, meist Hut obendrauf, auch Weste und feine Bauchbinde, die Damen heftig geschminkt, in sehr bunten Kleidern, oft mit Spitzenhandschuhen.  Eine Stadt tanzt Schieber, bald folgen Hunderte, auch die Jüngeren, die wenigen Touristen staunen und knipsen. Am Wochenende sind alle unterwegs, ein paar betuchte Väter steuern ihre Kleinen in Mercedes- und Ferrari-Nachbauten per Fernbedienung über den Platz, zur größten Freude der Väter selbst. Andere Familienväter schießen Ballons in den Abendhimmel, Kinder kreischen beseelt dazu bis spät in die Nacht, eine Idylle.
Eine Stadt tanzt Schieber, bald folgen Hunderte, auch die Jüngeren, die wenigen Touristen staunen und knipsen. Am Wochenende sind alle unterwegs, ein paar betuchte Väter steuern ihre Kleinen in Mercedes- und Ferrari-Nachbauten per Fernbedienung über den Platz, zur größten Freude der Väter selbst. Andere Familienväter schießen Ballons in den Abendhimmel, Kinder kreischen beseelt dazu bis spät in die Nacht, eine Idylle.
Zwischendurch Feuerwerk. Ein leicht alternativ verkleideter älterer Herr aus den USA klärt uns auf: ‚Oaxaca is probably the best of all Mexico, you will see‘. ‚Oaxaca ist vermutlich das Beste von Mexico überhaupt, Ihr werdet schon sehen.‘ Er nennt seinen Verkaufsstand am Samstag in einem Hausdurchgang ‚Little Farmers Market‘, seine Frau ist eine wunderschöne ältere Mexikanerin.  Im winzigen Patio ihres Hauses ziehen sie ein paar Würzkräuter, die verkaufen sie hier, ihr Markstand ist weniger Kleingewerbe als nachbarschaftlicher Kommunikationstreff. So friedlich, so einvernehmlich happy wie hier wird Mexiko für uns selten sein. Mexikaner scheinen sehr gut gelaunt, betont gelassen, neugierig, freundlich. Wir bleiben zu lange, eine Woche, und können uns doch kaum trennen. Oaxaca forever, schon schielen wir auf die Immobilienangebote, ab 150.000.- US-Dollar für ein schönes Stadthaus. Wir fahren weiter.
Im winzigen Patio ihres Hauses ziehen sie ein paar Würzkräuter, die verkaufen sie hier, ihr Markstand ist weniger Kleingewerbe als nachbarschaftlicher Kommunikationstreff. So friedlich, so einvernehmlich happy wie hier wird Mexiko für uns selten sein. Mexikaner scheinen sehr gut gelaunt, betont gelassen, neugierig, freundlich. Wir bleiben zu lange, eine Woche, und können uns doch kaum trennen. Oaxaca forever, schon schielen wir auf die Immobilienangebote, ab 150.000.- US-Dollar für ein schönes Stadthaus. Wir fahren weiter.
MEXIKO CITY
 Anflug auf Mexiko-City, Ankunft gegen Mittag. Hektik, etwas verstärkt durch die Gerüchte, dass hier nun wirklich allerlei passieren könnte, am Flughafen bereits. Deshalb haben wir ein teures Yellow Cab vom Flughafen zum Hotel gebucht bereits von Deutschland aus, wäre auch ohne gegangen stellen wir fest. Aber man muss wohl immer drauf achten, dass man ein wirkliches Taxi besteigt. Unterwegs erfahren wir, wir könnten nicht bis zum Hotel fahren, da sei eine Demonstration, die Straßen abgesperrt. Fast eine Stunde lang sind wir im Anflug nur über Stadtgebiet geflogen, jetzt erwarten wir Heftigstes. Dabei ist der Flughafen nicht weit vom Zocalo wo unser Hotel steht, es dauert trotzdem lange, andauernder, alltäglicher Verkehrs- Infarkt. Die Demo, das sind dann doch nur ein paar hundert Lehrer, die mit roten Fahnen bewaffnet gegen das Gebäude der Stadtverwaltung anschreien, streng bewacht von vielen Uniformierten.
Anflug auf Mexiko-City, Ankunft gegen Mittag. Hektik, etwas verstärkt durch die Gerüchte, dass hier nun wirklich allerlei passieren könnte, am Flughafen bereits. Deshalb haben wir ein teures Yellow Cab vom Flughafen zum Hotel gebucht bereits von Deutschland aus, wäre auch ohne gegangen stellen wir fest. Aber man muss wohl immer drauf achten, dass man ein wirkliches Taxi besteigt. Unterwegs erfahren wir, wir könnten nicht bis zum Hotel fahren, da sei eine Demonstration, die Straßen abgesperrt. Fast eine Stunde lang sind wir im Anflug nur über Stadtgebiet geflogen, jetzt erwarten wir Heftigstes. Dabei ist der Flughafen nicht weit vom Zocalo wo unser Hotel steht, es dauert trotzdem lange, andauernder, alltäglicher Verkehrs- Infarkt. Die Demo, das sind dann doch nur ein paar hundert Lehrer, die mit roten Fahnen bewaffnet gegen das Gebäude der Stadtverwaltung anschreien, streng bewacht von vielen Uniformierten.
 Das Hotel ‚Grand Hotel de Cuidad de Mexico‘ ist ein alter Kasten genau gegenüber der Nationalversammlung, die man kaum sehen kann, so riesig ist der Platz. Im Erdgeschoss der gesamten dem Platz zugewandten Seite Juweliere mit Bodyguards davor. Stiernacken unter schwarzen Klebescheiteln, sind sie das, die bösen Mexikaner ? Hotelhalle im ersten Stock, leicht schäbige Portiers, das Zimmer ganz oben und vom Platz weg ruhig, luxuriös, gediegen. Von der Webseite weiß ich, dass man den Preis halbieren kann, wenn man mehr als einen Monat vorher online bucht. Wir zahlen rund € 80.- für puren Luxus. Wo wir denn Geld wechseln könnten, fragen wir den ungepflegten Mann hinter dem Empfangstresen am nächsten Morgen. Er gibt uns ‚den besten Tipp der Stadt‘. Wir landen bei einer dubiosen Wechselstube um die Ecke, es geht um Dollars, der Kurs wird hingekritzelt, das Geld hingezählt, Quittung gibt es nicht. Später stellen wir fest, dass es fast überall in der City einen besseren Kurs gibt. Hat der Hotelportier Kommission für seinen Tipp bekommen ?
Das Hotel ‚Grand Hotel de Cuidad de Mexico‘ ist ein alter Kasten genau gegenüber der Nationalversammlung, die man kaum sehen kann, so riesig ist der Platz. Im Erdgeschoss der gesamten dem Platz zugewandten Seite Juweliere mit Bodyguards davor. Stiernacken unter schwarzen Klebescheiteln, sind sie das, die bösen Mexikaner ? Hotelhalle im ersten Stock, leicht schäbige Portiers, das Zimmer ganz oben und vom Platz weg ruhig, luxuriös, gediegen. Von der Webseite weiß ich, dass man den Preis halbieren kann, wenn man mehr als einen Monat vorher online bucht. Wir zahlen rund € 80.- für puren Luxus. Wo wir denn Geld wechseln könnten, fragen wir den ungepflegten Mann hinter dem Empfangstresen am nächsten Morgen. Er gibt uns ‚den besten Tipp der Stadt‘. Wir landen bei einer dubiosen Wechselstube um die Ecke, es geht um Dollars, der Kurs wird hingekritzelt, das Geld hingezählt, Quittung gibt es nicht. Später stellen wir fest, dass es fast überall in der City einen besseren Kurs gibt. Hat der Hotelportier Kommission für seinen Tipp bekommen ?
 Wir stürzen los, die Stadt ist überwältigend, voller Menschen, großes Geschiebe, aber scheint völlig unbedrohlich, tagsüber. Wir nehmen den ‚Turibus‘, aufschlussreich, zwei Touren, die eine, die rote führt in die City vorbei an Plätzen von imperialer Größe, die Zentral-Post, die Akademie des Artes – klassizistische Riesengebäude, hier und da auch monumentales Art Deco, sehr breite Straßen, sehr gewagte und gelungene moderne Architektur, überall wird gebaut, Aufschwung ? Große Grünanlagen, die Leute in der Sonne machen Mittagspause. Staunend werden wir durch wechselnde Viertel gefahren, die Stadt mal großkotzig, dann wieder bauhausig bescheiden, zwanziger Jahre leicht verlebt, runde Häuserecken, Zigarrenläden, Cafés, Bars. Bei Stop reckt ein LKW-Fahrer den Daumen hoch zu den Touristen auf dem Oberdeck des Busses, das gefällt dem Mexikaner, dass Leute kommen sein Land zu besuchen. Stellen wir öfter fest, man ist in Mexiko tief betroffen über den sehr schlechten Ruf, den das Land als Reiseland hat.
Wir stürzen los, die Stadt ist überwältigend, voller Menschen, großes Geschiebe, aber scheint völlig unbedrohlich, tagsüber. Wir nehmen den ‚Turibus‘, aufschlussreich, zwei Touren, die eine, die rote führt in die City vorbei an Plätzen von imperialer Größe, die Zentral-Post, die Akademie des Artes – klassizistische Riesengebäude, hier und da auch monumentales Art Deco, sehr breite Straßen, sehr gewagte und gelungene moderne Architektur, überall wird gebaut, Aufschwung ? Große Grünanlagen, die Leute in der Sonne machen Mittagspause. Staunend werden wir durch wechselnde Viertel gefahren, die Stadt mal großkotzig, dann wieder bauhausig bescheiden, zwanziger Jahre leicht verlebt, runde Häuserecken, Zigarrenläden, Cafés, Bars. Bei Stop reckt ein LKW-Fahrer den Daumen hoch zu den Touristen auf dem Oberdeck des Busses, das gefällt dem Mexikaner, dass Leute kommen sein Land zu besuchen. Stellen wir öfter fest, man ist in Mexiko tief betroffen über den sehr schlechten Ruf, den das Land als Reiseland hat.
Alles Nennenswerte wird abgefahren, auch das eher verlassene Olympiagelände von 1968, auch der Platz der Independencia, der Unabhängigkeit. Noch Tage später werden wir gefragt, ob wir denn auch die Independencia gesehen haben, die Mexikaner sind stolz darauf, alle Invasoren (besonders die Gringos) verjagt zu haben. Es ist brüllend heiß aber der viel gefürchtete Smog fehlt, es weht frisch. Dann eine den Tag bestimmende Entscheidung: wir nehmen auch noch die grüne Tour.
 Jetzt geht es weit raus an der Uni vorbei mit ihrem weltberühmten, ganz mit ‚Maya- Kunst‘ verzierten Bunker. Die Stadt ist unermesslich. Vororte wechseln, dann folgt eine Art pädagogische Einlage: wir fahren noch weiter raus nach Tlalpan, ein Vorort am Rande, morgens ist hier der Blumengroßmarkt der Stadt, heute längst vorbei. Auf einer ziemlich engen Einbahnstraße hinein und – nur Aufmerksame bemerken das, darauf hingewiesen wird nicht – vorbei an einer ‚Erziehungsanstalt‘, handelt sich wohl um ein Zuchthaus, Nato-Draht auf hohen Zäunen. Wenig später die Kehre, auf einer anderen Einbahnstraße zurück, da aber hält der Bus. Auf der Rückseite des Zuchthauses ein Vergnügungspark, Zuckerbäckerstände, Schaukeln, Familienväter mit Kleinkindern, eine Idylle, darüber ein Spruchband mit Aufmunterungen. Offenbar war es wichtig, den Touristen das vorzuführen, will sagen, wir kriegen das in den Griff, wenn wir uns kümmern muss niemand sich fürchten, so etwa.
Jetzt geht es weit raus an der Uni vorbei mit ihrem weltberühmten, ganz mit ‚Maya- Kunst‘ verzierten Bunker. Die Stadt ist unermesslich. Vororte wechseln, dann folgt eine Art pädagogische Einlage: wir fahren noch weiter raus nach Tlalpan, ein Vorort am Rande, morgens ist hier der Blumengroßmarkt der Stadt, heute längst vorbei. Auf einer ziemlich engen Einbahnstraße hinein und – nur Aufmerksame bemerken das, darauf hingewiesen wird nicht – vorbei an einer ‚Erziehungsanstalt‘, handelt sich wohl um ein Zuchthaus, Nato-Draht auf hohen Zäunen. Wenig später die Kehre, auf einer anderen Einbahnstraße zurück, da aber hält der Bus. Auf der Rückseite des Zuchthauses ein Vergnügungspark, Zuckerbäckerstände, Schaukeln, Familienväter mit Kleinkindern, eine Idylle, darüber ein Spruchband mit Aufmunterungen. Offenbar war es wichtig, den Touristen das vorzuführen, will sagen, wir kriegen das in den Griff, wenn wir uns kümmern muss niemand sich fürchten, so etwa.
 Endlos lang die Rückfahrt, es wird dunkel, auch im Abendlicht sind die hochmodernen Neubauten an der Prachtstraße Reforma eindrucksvoll. Als wir aussteigen, haben wir gut sieben Stunden auf dem Turibus verbracht, zu viel auf einmal. Abendessen auf der Dachterrasse des Hotels, das Essen schlecht (bis auf den Frozen Margerita, unser Lieblingsgift), der Blick auf den dunklen, leeren Platz wenig erhebend aber doch lehrreich: überall Blaulicht, an jeder Straßenecke Polizeiwagen, nicht nur am Platz. Wenn es dunkel wird, wandelt sich die Stadt zu einer an (fast) allen Ecken bewachten Festung. Der Wind weht sehr kalt (Januar), wir gehen ins Bett.
Endlos lang die Rückfahrt, es wird dunkel, auch im Abendlicht sind die hochmodernen Neubauten an der Prachtstraße Reforma eindrucksvoll. Als wir aussteigen, haben wir gut sieben Stunden auf dem Turibus verbracht, zu viel auf einmal. Abendessen auf der Dachterrasse des Hotels, das Essen schlecht (bis auf den Frozen Margerita, unser Lieblingsgift), der Blick auf den dunklen, leeren Platz wenig erhebend aber doch lehrreich: überall Blaulicht, an jeder Straßenecke Polizeiwagen, nicht nur am Platz. Wenn es dunkel wird, wandelt sich die Stadt zu einer an (fast) allen Ecken bewachten Festung. Der Wind weht sehr kalt (Januar), wir gehen ins Bett.
Frühstück im Ersten Stock. Die Kellner im dunkel holzgetäfelten Frühstücks-Raum altgedient, diskret und lässig, es gibt wunderbares Frühstück, auf Wunsch auch mexikanisch, was so viel heißt, wie Rühreier mit scharfen Peperoni, Tabasco, schwarzer Bohnenpampe, Schweinswürstchen. Probiert man nur einmal. Blick hinunter durch die halbrunden Fenster auf den Platz: alles zugestellt mit öffentlichen Fahrzeugen, Feuerwehr, Krankenwagen, Stadtreinigung, Militär, Polizei natürlich, dazwischen kleine offene Zelte, eine Art (sehr gut bewachtes) Volksfest ? Ein Rundgang über den sonst menschenleeren, jetzt so belebten Platz. Kinder lernen Fahrrad fahren, ein Rockband röhrt vor leeren Sitzplätzen, in einem Zelt zur ’sexuellen Aufklärung‘ herrscht Andrang und Heiterkeit, das Rote Kreuz, die staatliche Gesundheitspflege, was immer, alle sind da und informieren. Für einen normalen Tag ist es sehr gut besucht, schon am Vormittag, warum ? Am Wagen des Tourismusbüros fragen wir. Die Antwort: heute sei alles geschlossen, es sei nationaler Feiertag. Was es denn zu feiern gäbe, die Frage wird mit Achselzucken beantwortet, die Regierung habe einen nationalen Feiertag befohlen, warum, das
wisse niemand. Die Nationalversammlung, deren Treppenhaus das größte Wandbild von Diego Riviera beherbergt, ist auch geschlossen, schade.
 Jetzt laufen wir zu Fuß die Stadt ab – oder besser den kleinen Teil der Stadt, den man zu Fuß abschreiten kann. Um fünf nachmittags klingelt das Handy, Treffen am Frida-Kahlo-Museum in einer Stunde, eine nach Mexiko ausgewanderte Deutsche will uns ein Geschenk für die Freundin in Berlin mitgeben. Ein Blick auf den Stadtplan weist die Richtung, aber das genügt nicht, es ist unendlich weit zu Frida, am schnellsten zu erreichen mit dem Metrobus. Der rast mit großer Geschwindigkeit auf einer eigenen Trasse die sehr breite Straße Insurgentes Sur hinunter, mitfahren geht nicht, man muss ‚Mitglied‘ sein, wie uns einer erklärt. Dann geht es doch, ein freundlicher älterer Herr lädt uns ein, die Fahrt kostet nur ein paar Centavos, nur muss er seine Monatskarte an ein Sichtgerät halten, damit wir einsteigen können. Auch der bedankt sich dafür, dass wir Mexiko besuchen, wir sind gerührt.
Jetzt laufen wir zu Fuß die Stadt ab – oder besser den kleinen Teil der Stadt, den man zu Fuß abschreiten kann. Um fünf nachmittags klingelt das Handy, Treffen am Frida-Kahlo-Museum in einer Stunde, eine nach Mexiko ausgewanderte Deutsche will uns ein Geschenk für die Freundin in Berlin mitgeben. Ein Blick auf den Stadtplan weist die Richtung, aber das genügt nicht, es ist unendlich weit zu Frida, am schnellsten zu erreichen mit dem Metrobus. Der rast mit großer Geschwindigkeit auf einer eigenen Trasse die sehr breite Straße Insurgentes Sur hinunter, mitfahren geht nicht, man muss ‚Mitglied‘ sein, wie uns einer erklärt. Dann geht es doch, ein freundlicher älterer Herr lädt uns ein, die Fahrt kostet nur ein paar Centavos, nur muss er seine Monatskarte an ein Sichtgerät halten, damit wir einsteigen können. Auch der bedankt sich dafür, dass wir Mexiko besuchen, wir sind gerührt.
Zu Fuß noch zehn Minuten durch unbekannte Straßen mit kleinen bunten Häusern, wir sind zu spät. Die deutsche Dame wartet vor dem längst geschlossenen Museum, geschafft. Die Entfernungen in Mexiko-City, wenn man von der City und der Zone Rosa, der Touristenmeile, mal absieht, sind mörderisch. Wir wandern durch Coyoacan, nehmen einen Drink, dann noch einen. Wir wandern weiter in zunehmender Dunkelheit, in einem großen Gebäudekomplex in einer Nebenstraße das Gemeindezentrum, Gruppen sitzen zusammen, alt und jung, lernen zusammen, malen zusammen, in einem kleinen Halle üben sie zusammen Tango.
Weiter zu einem kleinen Dachrestaurant an einem sehr gemütlich und hübsch aussehenden Platz, riesige Bäume. Es sind nur wenige zu Fuß unterwegs aber offenbar hat niemand Befürchtungen, bedroht, beraubt zu werden. Coyoacan ist sicher, so heißt es. Das Essen so lala, schon nach zwei Wochen Mexiko begreift man, warum jeder Ausländer, der hier länger ist, nur immer Restaurants empfehlen würde, in denen nicht mexikanisch gekocht wird: nach zwei Wochen ist man durch mit den gängigen Varianten der immer gleichen Küche: man isst italienisch, europäisch, pazifisch – das gibt es überall.
Die deutsche Dame betont etwas häufig, wie gerne sie hier lebe und wirkt doch bedrückt, sie hat spürbar Heimweh, auch wenn, wie sie sagt, ‚da draußen, wo wir wohnen, alles ruhig ist, freundlich und nachbarschaftlich‘. Dann platzt es doch aus ihr heraus: der erwachsene Sohn ihres mexikanischen Mannes sei mal im eigenen Haus überfallen worden, festgehalten für Stunden mit Revolver an der Schläfe, liegend in einer Badewanne gefesselt. Dann seien die Täter aber ohne jede Spur verschwunden, nichts gestohlen, nichts. Vielleicht habe er nur dazu dienen sollen, den Tätern ein Alibi zu liefern, wenn es mal drauf ankommt – eine andere Erklärung hat seitdem niemand. Zur Polizei gehen, um Gottes Willen, das bringe gar nichts, provoziere nur die Rache der Gangster und die Polizei sei doch Teil der Bedrohung. Dann kommen sie doch, die Räuberpistolen, die in jedem Reiseführer stehen und die im Internet leidenschaftlich gern erzählt werden: z.B. wenn man einen Tipp zum Geld-Wechseln annähme, müsse man damit rechnen, das der, der den Tipp gegeben habe, seine Kumpels alarmiere, die dann, nach dem man das Geld bekommen habe, einem auf Schritt und Tritt folgten, bis sich eine Möglichkeit zu schnellem Zugriff böte. Ist da was dran ? Wir erleben so etwas auf der ganzen Reise nicht. Erstaunlich immerhin, dass auch Ansässige permanent solche Geschichten erzählen. Als wir nach dem Essen zwei Taxis bestellen, die dann kommen an den so stillen, friedfertigen Platz vor dem Restaurant im Szene-Stadtteil Coyoacan, beobachten wir wie lange hin und her verhandelt und telefonisch nachgefragt wird, ob es sich wirklich um Taxis handelt (die Autos haben keine Aufschrift, Schilder o.ä.). Offenbar sind einige der Schauergeschichten doch nicht nur ausgedacht. Ein falsches Taxi fährt Dich um die falsche Ecke und nimmt Dich gefangen, bis Du alles abgegeben hast, bis Deine Scheckkarten nix mehr hergeben. (Wir haben immer nur 1000 Peso dabei, keine Scheckkarten, von den Pässen nur Fotokopien.) Das Taxi fährt ewig lange zurück zum Hotel, kaum zu glauben, dass wir so weit weg waren, der Fahrer sprudelt über vor Begeisterung über Senora Merkel: ‚Money, NO !‘ die eiserne deutsche Lady wird viel belacht und bewundert. 40 Minuten ist das Taxi auf Schnellstraßen zu unserem Hotel gerast, Preis 120 Peso, da sind 7 Euro 60. Also: nachts nur mit Taxi, man muss nur sicher stellen, dass es auch eines ist.
 Dritter und unser letzter Tag in Mexiko-City, schade, die Furcht vor dem Moloch, vor dieser gefährlichen 20-Millionenstadt war zu groß, jetzt würden wir gern länger bleiben. Selbst den Platz der Organillos, der mexikanischen Drehorgeln Berliner Ursprungs und auch für den Platz der Mariachis, auf dem man zur Auswahl der Live-Hausmusik geht, falls man solche braucht, schaffen wir nicht. Morgens vom Frühstückstisch ein Blick auf den Platz, unter dem Fenster und überhaupt überall da unten stämmiges Wachpersonal in zu knappen dunklen Anzügen, die Muskel- Speck-Rolle schiebt sich über den zu engen weißen Hemdkragen, man steht herum, plaudert, macht Machogesten den wenigen Touristen hinterher, die jetzt schon wie verhuschte Heuschrecken in Gruppen über den Platz stolpern. Überall Ersatzpolizei. Oder sind das eher auch Gauner, die da die Juweliere und auch den einen oder anderen der Big Bosse bewachen, die jetzt mit zu großen Autos anrauschen ? Eine Delegation von solchen Bedeutungsträgern tagt im Hotel, deren Anzüge sitzen besser. In der Hotelhalle fast nur Bodyguards.
Dritter und unser letzter Tag in Mexiko-City, schade, die Furcht vor dem Moloch, vor dieser gefährlichen 20-Millionenstadt war zu groß, jetzt würden wir gern länger bleiben. Selbst den Platz der Organillos, der mexikanischen Drehorgeln Berliner Ursprungs und auch für den Platz der Mariachis, auf dem man zur Auswahl der Live-Hausmusik geht, falls man solche braucht, schaffen wir nicht. Morgens vom Frühstückstisch ein Blick auf den Platz, unter dem Fenster und überhaupt überall da unten stämmiges Wachpersonal in zu knappen dunklen Anzügen, die Muskel- Speck-Rolle schiebt sich über den zu engen weißen Hemdkragen, man steht herum, plaudert, macht Machogesten den wenigen Touristen hinterher, die jetzt schon wie verhuschte Heuschrecken in Gruppen über den Platz stolpern. Überall Ersatzpolizei. Oder sind das eher auch Gauner, die da die Juweliere und auch den einen oder anderen der Big Bosse bewachen, die jetzt mit zu großen Autos anrauschen ? Eine Delegation von solchen Bedeutungsträgern tagt im Hotel, deren Anzüge sitzen besser. In der Hotelhalle fast nur Bodyguards.
Wieder zu Fuß unterwegs.  In der Zentralpost der Stadt Mexiko kriegen wir einen Begeisterungsanfall und knipsen fast eine Dreiviertelstunde lang die Gitter, Stiegen, Fahrstühle, Publikumstresen und Gemälde aus den vorvorigen Jahrhundert. Vor der Tür die komplette Mannschaft der Star-Wars in vollem Kostüm darf man selbst nicht knipsen, die leben davon, Dir ein Bild von sich und Dir zu machen. Abends sind wir auf Empfehlung des ARD-Korrespondenten in einem schicken Restaurant um die Ecke von unserem Hotel, also direkt auf dem Touristen-Nepp-Strich. Design-Hotel mit Innenhof-Restaurant, sehr entschlossen gestylt, nur Kerzen auf dem Tisch, das Essen ist so kaum zu erkennen – und es ist voll besetzt, es gibt auch Mexikaner, die gern viel Geld ausgeben. Wir weichen aus ins benachbarte, genau so teure, weniger frequentierte Fischrestaurant. Und jetzt passiert etwas, was wir in Mexiko immer wieder erleben: es kommen Drinks, die nicht schmecken – bei Reklamation reagiert man gelassen: Schmeckt nicht ? Hole ich was Anderes ! Der zweite Drink ist OK. Beim Essen ebenso: Das soll Red Snapper sein, wie bestellt ? Ach was, ist das Dorade ? Kein Problem, was dann kommt, schmeckt auch nicht besonders, ist aber teuer. Das lassen wir ab jetzt. Aber Mexico-City ist eine Reise wert.
In der Zentralpost der Stadt Mexiko kriegen wir einen Begeisterungsanfall und knipsen fast eine Dreiviertelstunde lang die Gitter, Stiegen, Fahrstühle, Publikumstresen und Gemälde aus den vorvorigen Jahrhundert. Vor der Tür die komplette Mannschaft der Star-Wars in vollem Kostüm darf man selbst nicht knipsen, die leben davon, Dir ein Bild von sich und Dir zu machen. Abends sind wir auf Empfehlung des ARD-Korrespondenten in einem schicken Restaurant um die Ecke von unserem Hotel, also direkt auf dem Touristen-Nepp-Strich. Design-Hotel mit Innenhof-Restaurant, sehr entschlossen gestylt, nur Kerzen auf dem Tisch, das Essen ist so kaum zu erkennen – und es ist voll besetzt, es gibt auch Mexikaner, die gern viel Geld ausgeben. Wir weichen aus ins benachbarte, genau so teure, weniger frequentierte Fischrestaurant. Und jetzt passiert etwas, was wir in Mexiko immer wieder erleben: es kommen Drinks, die nicht schmecken – bei Reklamation reagiert man gelassen: Schmeckt nicht ? Hole ich was Anderes ! Der zweite Drink ist OK. Beim Essen ebenso: Das soll Red Snapper sein, wie bestellt ? Ach was, ist das Dorade ? Kein Problem, was dann kommt, schmeckt auch nicht besonders, ist aber teuer. Das lassen wir ab jetzt. Aber Mexico-City ist eine Reise wert.
CHIAPA DE CORZO
 Flug nach Tuxla Gutierrez, nach Süden ins Indioland. Dort wartet ein sehr dicker Mann, der fließend deutsch spricht aber Mexikaner ist, Mauricio hat in Deutschland gearbeitet. Er wird uns nach San Cristobal de las Casas fahren, in die Hochburg der alternativen Mexiko-Touristen und vor allem die Hauptstadt der Chiapas, jenem aufsässigen Indio-Stamm, der 1999 die Zentralregierung in Verlegenheit brachte, weil die Chiapas sich gegen die Landverkäufe in der Region wehrten, in den Bergen von Chiapas findet sich Uran. Auf dem Weg dahin sollen wir eine Sehenswürdigkeit ‚mitnehmen‘, den Canyon von Sumidero. Der Fluss Grijalva fließt da durch bis zu 1000 Meter hohe Steilwände, imposant, jedenfalls auf Google Earth. 14, 16 Leute mit Schwimmwesten auf einer Art Schnellboot, das im Affenzahn den Canyon hochjagt, immer schön hart aufschlagend aufs Wasser. Viel Gegenwind, wenn wir die Wattejacken unserer Skiausrüstung nicht hätten, wär’s nicht auszuhalten. Die mexikanischen Touristen um uns herum (Amis gibt es ab jetzt kaum mehr) sitzen da im T-Shirt und bibbern. Die Steilwände sind eindrucksvoll, die Affen, die in 200 Meter Höhe herumturnen sollen, sieht man kaum, für Krokodile ist es zu kalt, nur Aasgeier hocken in ganzen Kolonien am Ufer. Es gibt keine Ruhepausen, die wenigen Ansagen sind auf Spanisch und auf der noch eiligeren Rückfahrt fallen auch die weg. Gut zwei Stunden dauert das, sollte man sich sparen.
Flug nach Tuxla Gutierrez, nach Süden ins Indioland. Dort wartet ein sehr dicker Mann, der fließend deutsch spricht aber Mexikaner ist, Mauricio hat in Deutschland gearbeitet. Er wird uns nach San Cristobal de las Casas fahren, in die Hochburg der alternativen Mexiko-Touristen und vor allem die Hauptstadt der Chiapas, jenem aufsässigen Indio-Stamm, der 1999 die Zentralregierung in Verlegenheit brachte, weil die Chiapas sich gegen die Landverkäufe in der Region wehrten, in den Bergen von Chiapas findet sich Uran. Auf dem Weg dahin sollen wir eine Sehenswürdigkeit ‚mitnehmen‘, den Canyon von Sumidero. Der Fluss Grijalva fließt da durch bis zu 1000 Meter hohe Steilwände, imposant, jedenfalls auf Google Earth. 14, 16 Leute mit Schwimmwesten auf einer Art Schnellboot, das im Affenzahn den Canyon hochjagt, immer schön hart aufschlagend aufs Wasser. Viel Gegenwind, wenn wir die Wattejacken unserer Skiausrüstung nicht hätten, wär’s nicht auszuhalten. Die mexikanischen Touristen um uns herum (Amis gibt es ab jetzt kaum mehr) sitzen da im T-Shirt und bibbern. Die Steilwände sind eindrucksvoll, die Affen, die in 200 Meter Höhe herumturnen sollen, sieht man kaum, für Krokodile ist es zu kalt, nur Aasgeier hocken in ganzen Kolonien am Ufer. Es gibt keine Ruhepausen, die wenigen Ansagen sind auf Spanisch und auf der noch eiligeren Rückfahrt fallen auch die weg. Gut zwei Stunden dauert das, sollte man sich sparen.
 Zum Essen und mit erwartungsbangem Vibrato in der Stimme kündet Mauricio einen Zwischenstopp in Chiapa de Corzo an, einem Dorf auf dem Weg in die Berge. Wie von ihm erhofft, von uns nicht erwartet, wird das zu einem zentralen Erlebnis der Reise: Der (im Januar/Februar) tägliche Tanz der Maya-Abkömmlinge zur Bewältigung der Jahrhunderte zurück liegenden Schmach der Eroberung und Unterjochung durch die Spanier. Unter Trommelwirbeln und Massengehopse kommen sie die Hauptstraße hoch, die Mädchen und Frauen in festlichen Kleidern, stickblumen-übersäht, die Männer (und Jungens) aber mit einer Art Bürstenhut, wie riesengroße Abwaschbürsten auf den Köpfen, vor den Gesichtern lackierte Holzmasken. Sie stellen die blonden (!) Spanier dar, die sie damals überfallen haben und jetzt treiben sie diese aus, zu Ehren des Heiligen San Sebastian.
Zum Essen und mit erwartungsbangem Vibrato in der Stimme kündet Mauricio einen Zwischenstopp in Chiapa de Corzo an, einem Dorf auf dem Weg in die Berge. Wie von ihm erhofft, von uns nicht erwartet, wird das zu einem zentralen Erlebnis der Reise: Der (im Januar/Februar) tägliche Tanz der Maya-Abkömmlinge zur Bewältigung der Jahrhunderte zurück liegenden Schmach der Eroberung und Unterjochung durch die Spanier. Unter Trommelwirbeln und Massengehopse kommen sie die Hauptstraße hoch, die Mädchen und Frauen in festlichen Kleidern, stickblumen-übersäht, die Männer (und Jungens) aber mit einer Art Bürstenhut, wie riesengroße Abwaschbürsten auf den Köpfen, vor den Gesichtern lackierte Holzmasken. Sie stellen die blonden (!) Spanier dar, die sie damals überfallen haben und jetzt treiben sie diese aus, zu Ehren des Heiligen San Sebastian.  Jetzt gilt auch nicht das Fotoverbot, dass die Chiapas sonst so streng handhaben sollen, man baut sich bereitwillig auf, einzeln und in Gruppen, um sich knipsen zu lassen, stürzt dann wieder los, einer ausgelassenen Massentrance folgend, hin zur Kirche – und wieder weg. Das wirkt nicht nur fremd, wie da die Halbstarken größte Freude am gemeinschaftlichen Veitstanz haben, zwischendurch ihr iPhone zücken und sich und den Freunden offenbar in aller Welt ‚posten‘, wie Mütter auf der Straße kniend ihre Allerjüngsten verkleiden und aufputzen. In der Kirche schließlich bei all dem Krach, eine kleine Blechblaskapelle spielt auf, dann doch so was wie heiliger Ernst.
Jetzt gilt auch nicht das Fotoverbot, dass die Chiapas sonst so streng handhaben sollen, man baut sich bereitwillig auf, einzeln und in Gruppen, um sich knipsen zu lassen, stürzt dann wieder los, einer ausgelassenen Massentrance folgend, hin zur Kirche – und wieder weg. Das wirkt nicht nur fremd, wie da die Halbstarken größte Freude am gemeinschaftlichen Veitstanz haben, zwischendurch ihr iPhone zücken und sich und den Freunden offenbar in aller Welt ‚posten‘, wie Mütter auf der Straße kniend ihre Allerjüngsten verkleiden und aufputzen. In der Kirche schließlich bei all dem Krach, eine kleine Blechblaskapelle spielt auf, dann doch so was wie heiliger Ernst.
 Wir können uns nicht trennen, nach dem Essen bestehen wir darauf, auch noch auf
Wir können uns nicht trennen, nach dem Essen bestehen wir darauf, auch noch auf
den entsprechenden Rummel zu gehen. Mauricio quittiert das mit Stöhnen, wird ein langer Arbeitstag für ihn, aber ‚das sieht man nur einmal im Leben‘, er wird warten, wir sind dankbar. Der Jahrmarkt hat viel Ähnlichkeit mit so was bei uns, nur hier gibt es auch eine simple wackelige Gondel-Drahtseilbahn über das ganze Gelände, viele Fressbuden mit sehr scharfen oder sehr süßen Sachen und die immer noch verkleideten, schnell immer betrunkeneren Indigenos und Indigenas.
 Beglückt eilen wir zurück zum Kleinbus, längst ist es dunkel, noch einmal eineinhalb Stunden hoch in die Berge, dann liegt es da glitzernd in der totalen Finsternis in einem Hochtal, San Cristobal. Das sehr schön aussehende Hotel ist gar nicht schön, wie oft in Mexiko viel zu laut um die Zimmer herum. Wir erstreiten ein Zimmer in der Dependance, ganz hinten, wo keiner mehr vorbei geht, die Betten sind eiskalt,
Beglückt eilen wir zurück zum Kleinbus, längst ist es dunkel, noch einmal eineinhalb Stunden hoch in die Berge, dann liegt es da glitzernd in der totalen Finsternis in einem Hochtal, San Cristobal. Das sehr schön aussehende Hotel ist gar nicht schön, wie oft in Mexiko viel zu laut um die Zimmer herum. Wir erstreiten ein Zimmer in der Dependance, ganz hinten, wo keiner mehr vorbei geht, die Betten sind eiskalt,
wir müssen heizen. Nachts um drei wird noch jemand lautstark sein Fahrrad an unsere Zimmertür lehnen, unmöglich.
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
 Morgens, draußen noch um Null Grad, kommt der Wagen, Tour Eins. Fazit vorweg: zu viel Fahren, endloses Fahren, für relativ wenig. So ist das in Ländern mit begrenzten Sehenswürdigkeiten – oder besser in Ländern, wo die Fremdenführer noch nicht begriffen haben, was alles sehenswürdig ist. Wir preschen stundenlang durch die Gegend, von Tropfsteinhöhle zu Wasserfall und zu einem schönen See an der Grenze zu Guatemala, wir halten zu selten, bekommen zu wenig erklärt, der indianische Alltag, der an uns vorberauscht, scheint dem sehr eloquent englisch parlierenden Tour-Guide nicht interessant. Er muss sein Pensum schaffen, wichtig, und das ist gewaltig. Die Tropfsteinhöhle ist nicht der Rede wert, umgeben von Vergnügungs-Einrichtungen, die stark an die versunkene DDR erinnern, öde, leblos, noch dazu in Dreilinden-Graugrün gestrichene Blechhütten. Weiter, weiter, wir bewegen uns nahe der Grenze zu Guatemala, Road Blocks hier und da, Sandsäcke, Schießstände, sogar Panzer, Geschütze, richten sich gegen den imaginären Feind.
Morgens, draußen noch um Null Grad, kommt der Wagen, Tour Eins. Fazit vorweg: zu viel Fahren, endloses Fahren, für relativ wenig. So ist das in Ländern mit begrenzten Sehenswürdigkeiten – oder besser in Ländern, wo die Fremdenführer noch nicht begriffen haben, was alles sehenswürdig ist. Wir preschen stundenlang durch die Gegend, von Tropfsteinhöhle zu Wasserfall und zu einem schönen See an der Grenze zu Guatemala, wir halten zu selten, bekommen zu wenig erklärt, der indianische Alltag, der an uns vorberauscht, scheint dem sehr eloquent englisch parlierenden Tour-Guide nicht interessant. Er muss sein Pensum schaffen, wichtig, und das ist gewaltig. Die Tropfsteinhöhle ist nicht der Rede wert, umgeben von Vergnügungs-Einrichtungen, die stark an die versunkene DDR erinnern, öde, leblos, noch dazu in Dreilinden-Graugrün gestrichene Blechhütten. Weiter, weiter, wir bewegen uns nahe der Grenze zu Guatemala, Road Blocks hier und da, Sandsäcke, Schießstände, sogar Panzer, Geschütze, richten sich gegen den imaginären Feind.
 Danach, an den Grenzseen Lagunas de Montebello, ist es paradiesisch ruhig, wir Touristen erzwingen eine Pause, völlig ungehemmt und gegen alle Warnungen hocken wir uns in eine der schäbigen Hütten, die Einheimische da aufgebaut haben und essen, was immer die auf offenem Feuer bereiten. Mexiko ist sauber, selbst auf der Straße kocht man annähernd hygienisch, keiner hockt im Dreck mit Kochtopf wie etwa in Vietnam. Nie und nirgends holen wir uns in diesen fünf Wochen auch nur die leiseste Magenverstimmung.
Danach, an den Grenzseen Lagunas de Montebello, ist es paradiesisch ruhig, wir Touristen erzwingen eine Pause, völlig ungehemmt und gegen alle Warnungen hocken wir uns in eine der schäbigen Hütten, die Einheimische da aufgebaut haben und essen, was immer die auf offenem Feuer bereiten. Mexiko ist sauber, selbst auf der Straße kocht man annähernd hygienisch, keiner hockt im Dreck mit Kochtopf wie etwa in Vietnam. Nie und nirgends holen wir uns in diesen fünf Wochen auch nur die leiseste Magenverstimmung.
Interessante Feststellung, ich zahle mehr als die Anderen (immer noch sehr wenig) und protestiere. ‚Zu spät‘ erklären zwei hübsche dicke mexikanische Mädchen aus unserer Gruppe. Für Touristen ist’s teurer, es sei denn, sie fragen vorher nach dem Preis, nachher ist eben ‚zu spät‘. Merke ich mir. Passiert hin und wieder, selbst den Trick mit dem Nuscheln haben die Taxifahrer schon drauf: wie viel kostet die Tour ? „XXXty“ ! man glaubt zu verstehen und nickt, steigt ein. Am Ende ist es dann mehr als angemessen. Beim Taxipreis aushandeln also immer zu zweit, wenn möglich oder die Summe irgendwo hinkritzeln, dann ist ‚falsch verstanden‘ kaum möglich. Einfacher: beim Taxi am Ziel das an Geld überreichen, was hinhauen könnte und wortlos aussteigen. Da hat noch jeder protestiert und dann doch klein beigegeben – deshalb immer Kleingeld dabei haben und etwas Mut. Am letzten aber wirklich sehr schönen ‚Chiflon‘-Wasserfall erwischt es unseren gehetzten Fremdenführer, in einer Stunde mögen alle zurück sein, es sei noch ein langer Weg nach Hause (2 Stunden mindestens).  Der Wasserfall ist schlank, tosend und hoch und wir beginnen mit dem Aufstieg, gegen alle Vernunft, in Kürze wird es dunkel. Bald verschwinden die Treppchen und Geländer, es hilft nur noch Kraxeln und Kriechen auf allen Vieren. Aber wie das so ist in einer Gruppe, wer will da schon schlapp machen. Irgendwann, mit hoch geröteten Köpfen stehen wir alle glücklich grinsend oben auf der allerhöchsten Plattform überm Wasserfall, ein enormer Blick tut sich auf in die anschließende Ebene, wunderschön. Als erste beginnen wir zwei mit dem Abstieg, noch gar nicht richtig von Aufstieg erholt – und wir sind die Einzigen. Keiner sonst denkt an das, was kommt, an die Dunkelheit. Wir tasten uns sicher runter. Die Anderen müssen geholt werden, mit der Parkaufsicht und Taschenlampen, der Zeitplan purzelt, als wir kurz vor Mitternacht im Hotel sind gibt es nur noch ein Süppchen.
Der Wasserfall ist schlank, tosend und hoch und wir beginnen mit dem Aufstieg, gegen alle Vernunft, in Kürze wird es dunkel. Bald verschwinden die Treppchen und Geländer, es hilft nur noch Kraxeln und Kriechen auf allen Vieren. Aber wie das so ist in einer Gruppe, wer will da schon schlapp machen. Irgendwann, mit hoch geröteten Köpfen stehen wir alle glücklich grinsend oben auf der allerhöchsten Plattform überm Wasserfall, ein enormer Blick tut sich auf in die anschließende Ebene, wunderschön. Als erste beginnen wir zwei mit dem Abstieg, noch gar nicht richtig von Aufstieg erholt – und wir sind die Einzigen. Keiner sonst denkt an das, was kommt, an die Dunkelheit. Wir tasten uns sicher runter. Die Anderen müssen geholt werden, mit der Parkaufsicht und Taschenlampen, der Zeitplan purzelt, als wir kurz vor Mitternacht im Hotel sind gibt es nur noch ein Süppchen.
 Am nächsten Tag soll’s erst um 12:00 losgehen, wir erkunden die Stadt. San Cristobal ist viel schicker als es sein dürfte, hier oben, umgeben von den ‚wilden Chiapas‘, bei gut 2000 Meter Höhe und winterlichen Temperaturen. Viele Traveller, was hier die gängige Bezeichnung für die Lonely-Planet-Möchtegern-Hippies ist. Die sitzen überall, nicht selten betrunken oder high, der Stoff, von dem alle erzählen, dass der hier an jeder Straßenecke zu haben ist – und der für den bedrohlichen Alltag in Mexiko verantwortlich ist – dieser Stoff wird offenbar von vielen probiert. Polizei sehen wir hier kaum. Dafür Schnapsläden, Outdoor-Boutiquen, Straßencafés. Der Chiapas-Kaffee, hier gezogen, hier geröstet, ist der beste auf der ganzen Reise.
Am nächsten Tag soll’s erst um 12:00 losgehen, wir erkunden die Stadt. San Cristobal ist viel schicker als es sein dürfte, hier oben, umgeben von den ‚wilden Chiapas‘, bei gut 2000 Meter Höhe und winterlichen Temperaturen. Viele Traveller, was hier die gängige Bezeichnung für die Lonely-Planet-Möchtegern-Hippies ist. Die sitzen überall, nicht selten betrunken oder high, der Stoff, von dem alle erzählen, dass der hier an jeder Straßenecke zu haben ist – und der für den bedrohlichen Alltag in Mexiko verantwortlich ist – dieser Stoff wird offenbar von vielen probiert. Polizei sehen wir hier kaum. Dafür Schnapsläden, Outdoor-Boutiquen, Straßencafés. Der Chiapas-Kaffee, hier gezogen, hier geröstet, ist der beste auf der ganzen Reise.
 Mittags steht Mauricio wieder da und wartet auf uns, wir fahren zu Indio-Dörfern in der Umgebung, und wir sind die Einzigen im VW-Bus. Ende der Wasserfälle, vorerst. Jetzt bekommen wir, was wir suchen. Ein paar Kilometer nur entfernt ist die Welt eine andere. Indiofrauen waschen Wäsche im Bach, da hingehen soll aber nur die Dame unter uns Reisenden, wenn ein Mann sich näherte könnten die sich bedroht fühlen – und bloß keine Fotos !! Wir warten. Beglückt kehrt unsere einzige Dame zurück, man hat sich prächtig über die neugierige Fremde amüsiert, Lächeln und Winken, wir fahren weiter. Auf dem Platz vor der Kirche Geballer. Da sitzt ein Jüngling und füllt bechergroße Stahlrohr-Enden mit dunklem Pulver, stopft das fest mit einem Holzhämmerchen, dann taumelt einer der angetrunkenen älteren Männer herbei, zündet an der Röhre eine Lunte und hält alles weit weg vom Körper. Mit enormem Knall entlädt sich der Stoff, die Hand des trunkenen Pyromanen wird nach hinten geschleudert, er lächelt, schlurft wankend zur Schnapsflasche zurück. Das dunkle Pulver ist Schwarzpulver, wir dürfen nicht näher ran, gefährlich. Eine indigene Mutprobe zur Feier des heiligen San Sebastian. Der Nächste tritt heran, blickt ängstlich auf die Röhre in seiner Rechten, nimmt einen Schluck, gibt sich einen Ruck … Ein japanisch aussehender Tourist filmt alles unbeirrt mit seinem iPad.
Mittags steht Mauricio wieder da und wartet auf uns, wir fahren zu Indio-Dörfern in der Umgebung, und wir sind die Einzigen im VW-Bus. Ende der Wasserfälle, vorerst. Jetzt bekommen wir, was wir suchen. Ein paar Kilometer nur entfernt ist die Welt eine andere. Indiofrauen waschen Wäsche im Bach, da hingehen soll aber nur die Dame unter uns Reisenden, wenn ein Mann sich näherte könnten die sich bedroht fühlen – und bloß keine Fotos !! Wir warten. Beglückt kehrt unsere einzige Dame zurück, man hat sich prächtig über die neugierige Fremde amüsiert, Lächeln und Winken, wir fahren weiter. Auf dem Platz vor der Kirche Geballer. Da sitzt ein Jüngling und füllt bechergroße Stahlrohr-Enden mit dunklem Pulver, stopft das fest mit einem Holzhämmerchen, dann taumelt einer der angetrunkenen älteren Männer herbei, zündet an der Röhre eine Lunte und hält alles weit weg vom Körper. Mit enormem Knall entlädt sich der Stoff, die Hand des trunkenen Pyromanen wird nach hinten geschleudert, er lächelt, schlurft wankend zur Schnapsflasche zurück. Das dunkle Pulver ist Schwarzpulver, wir dürfen nicht näher ran, gefährlich. Eine indigene Mutprobe zur Feier des heiligen San Sebastian. Der Nächste tritt heran, blickt ängstlich auf die Röhre in seiner Rechten, nimmt einen Schluck, gibt sich einen Ruck … Ein japanisch aussehender Tourist filmt alles unbeirrt mit seinem iPad.
 Dann in die Kirche, hier absolut keine Aufnahmen, wir werden noch einmal gewarnt. Ein großes helles Kirchenschiff, an beiden Längsseiten bis hoch zu den Fenstern ein Meer frischer weißer Blumen. Der helle Marmorboden ist mit Gras ausgelegt, darauf hocken die Frauen und Kinder in Gruppen, überall kokelt es, jede Gruppe hat ihr eigenes kleines Feuer, ihre eigene Weihrauchpfanne und nebelt sich ein. Vorn am Altar Gedränge, wir halten uns zurück. Neben uns postieren sich 20 Männer in Zweierreihe, den Blick zum Altar, bekleidet mit so etwas wie Flokati in weiß. Brettharte Teppiche als Cape, dicker Ledergürtel, verschwommener Blick. Geige und Akkordeon beginnen eine traurige schleppende Melodie, die zwanzig Männer schlurfen vor und zurück, immer Zentimeter nur, brummen ein waberndes OMM und unterbrechen nur, um wieder und wieder aus Cola-Flaschen zu trinken. Jetzt sieht man es, Coca-Cola überall, Kisten stehen herum, neue werden herangeschleppt, man scheint süchtig nach dem Stoff. Was ist hier los ? Für die Antwort müssen wir raus, hier stört selbst Flüstern, bei aller Fremdheit wirkt alles sehr feierlich.
Dann in die Kirche, hier absolut keine Aufnahmen, wir werden noch einmal gewarnt. Ein großes helles Kirchenschiff, an beiden Längsseiten bis hoch zu den Fenstern ein Meer frischer weißer Blumen. Der helle Marmorboden ist mit Gras ausgelegt, darauf hocken die Frauen und Kinder in Gruppen, überall kokelt es, jede Gruppe hat ihr eigenes kleines Feuer, ihre eigene Weihrauchpfanne und nebelt sich ein. Vorn am Altar Gedränge, wir halten uns zurück. Neben uns postieren sich 20 Männer in Zweierreihe, den Blick zum Altar, bekleidet mit so etwas wie Flokati in weiß. Brettharte Teppiche als Cape, dicker Ledergürtel, verschwommener Blick. Geige und Akkordeon beginnen eine traurige schleppende Melodie, die zwanzig Männer schlurfen vor und zurück, immer Zentimeter nur, brummen ein waberndes OMM und unterbrechen nur, um wieder und wieder aus Cola-Flaschen zu trinken. Jetzt sieht man es, Coca-Cola überall, Kisten stehen herum, neue werden herangeschleppt, man scheint süchtig nach dem Stoff. Was ist hier los ? Für die Antwort müssen wir raus, hier stört selbst Flüstern, bei aller Fremdheit wirkt alles sehr feierlich.
 Vor der Tür also: was war denn das ? Das war eine christliche Messe, alle sind hier entschlossen katholisch, die Messe aber durchsetzt mit den alten heidnischen Bräuchen, warum soll man nicht mehrere Götter haben ? Ob wir das nicht gehört hätten, die Kreischen alle paar Minuten, vorn am Altar. Das sei der Pfarrer, der dann immer einem Huhn den Kopf abreißt, Blutopfer, wie vorgeschrieben seit der Zeit der Mayas. Aber verbrannt würden die Hühner danach nun nicht mehr, die nehme man mit nach Hause, die esse man auf. Und die Cola ? Unglaubliche Geschichte: Es sei immer Vorschrift gewesen, durch einen Schluck Schnaps am Beginn des Rituals seine Seele zu reinigen bevor man vor seinen Gott tritt. Früher sei das Schnaps gewesen, auch mal Likör, und damit die Folgen übersehbar blieben, war es üblich, dass man den Schnaps nicht schluckte, sondern nach Spülung des Rachens wieder ausspuckte. Teurer Spaß, überall klebrige Pfützen und nicht ungefährlich weil bald nicht mehr als eine willkommene Gelegenheit, sich zu betrinken. Das aber habe ein Vertreter von Coca-Cola mitgekriegt und der habe erfolgreich den Bürgermeister bearbeitet. Auch Cola würde die Seele reinigen, das sei allgemein bekannt und die brauche man nicht auszuspucken, die sei sogar gesund. Ein Scheck für den Bürgermeister und einer für den Neubau der Schule haben den Deal besiegelt. Seitdem trinkt man in Chiapas Cola, wenn es um innere Reinigung geht, Cola in rauen Mengen. (Mexiko hat den größten pro-Kopf-Coca-Cola-Konsum der Welt).
Vor der Tür also: was war denn das ? Das war eine christliche Messe, alle sind hier entschlossen katholisch, die Messe aber durchsetzt mit den alten heidnischen Bräuchen, warum soll man nicht mehrere Götter haben ? Ob wir das nicht gehört hätten, die Kreischen alle paar Minuten, vorn am Altar. Das sei der Pfarrer, der dann immer einem Huhn den Kopf abreißt, Blutopfer, wie vorgeschrieben seit der Zeit der Mayas. Aber verbrannt würden die Hühner danach nun nicht mehr, die nehme man mit nach Hause, die esse man auf. Und die Cola ? Unglaubliche Geschichte: Es sei immer Vorschrift gewesen, durch einen Schluck Schnaps am Beginn des Rituals seine Seele zu reinigen bevor man vor seinen Gott tritt. Früher sei das Schnaps gewesen, auch mal Likör, und damit die Folgen übersehbar blieben, war es üblich, dass man den Schnaps nicht schluckte, sondern nach Spülung des Rachens wieder ausspuckte. Teurer Spaß, überall klebrige Pfützen und nicht ungefährlich weil bald nicht mehr als eine willkommene Gelegenheit, sich zu betrinken. Das aber habe ein Vertreter von Coca-Cola mitgekriegt und der habe erfolgreich den Bürgermeister bearbeitet. Auch Cola würde die Seele reinigen, das sei allgemein bekannt und die brauche man nicht auszuspucken, die sei sogar gesund. Ein Scheck für den Bürgermeister und einer für den Neubau der Schule haben den Deal besiegelt. Seitdem trinkt man in Chiapas Cola, wenn es um innere Reinigung geht, Cola in rauen Mengen. (Mexiko hat den größten pro-Kopf-Coca-Cola-Konsum der Welt).
Der Bürgermeister von Zinacantàn hat Glück gehabt, dass sie ihm das abgenommen haben. Den Bürgermeister vom Nachbardorf Chamula, nur acht Kilometer entfernt über den Berg, den habe man nachts ermordet und seine Familie verjagt, nur weil der um jeden Preis die reformierte Kirche habe einführen wollen, ohne Schnaps und ohne Cola. In dieses Nachbardorf fahren wir jetzt. Wieder ein großer Dorfplatz, eine Blaskapelle spielt, 15 Mann und so was wie Zirkusmusik. Zentraler Markt, die Gesichter hier düsterer, die Blicke noch abgewandter, Touristen werden ignoriert. Hier kommen die Männer in ihren Flokati-Umhängen auf Pferden durch die Menge geprescht, man hält vor dem Rathaus, großes Palaver, viel Schnaps.
 Wir gehen bald wieder, nicht ungern, die nebenan waren freundlicher, sogar ein Haus haben wir dort noch besucht, gebaut aus Lehm, die ganze Großfamilie lebt dort zusammen, die Alten besonders geehrt, die Frauen haben das Sagen. Webstuhl, Hausaltar, Schlafraum, Kochstelle, alles unter einem Dach. Späteres Nachfragen macht erst klar, dass das wohl eher ein Haus für neugierige Touristen war, niemand würde unter einem Dach schlafen und kochen, der Rauch und der Ruß der offenen Feuerstelle würde alles verderben, man kocht vor dem Haus, so ist das üblich. Ein Blick noch auf den Friedhof, endlich können wir fragen, warum dort die vielen kleinen Häuser wie Hundehütten über den Gräbern stehen. Früher habe man in Chiapas die Toten im Hause begraben, im Lehmboden unter dem Wohnraum. Das hätten die spanischen Missionare aber verboten, das war denen ein zu deutlich unchristlicher Ahnenkult. Also baue man jetzt die Häuser über die Toten, damit die keinen Grund hätten sich zu beschweren, dass sie falsch beerdigt worden seien.
Wir gehen bald wieder, nicht ungern, die nebenan waren freundlicher, sogar ein Haus haben wir dort noch besucht, gebaut aus Lehm, die ganze Großfamilie lebt dort zusammen, die Alten besonders geehrt, die Frauen haben das Sagen. Webstuhl, Hausaltar, Schlafraum, Kochstelle, alles unter einem Dach. Späteres Nachfragen macht erst klar, dass das wohl eher ein Haus für neugierige Touristen war, niemand würde unter einem Dach schlafen und kochen, der Rauch und der Ruß der offenen Feuerstelle würde alles verderben, man kocht vor dem Haus, so ist das üblich. Ein Blick noch auf den Friedhof, endlich können wir fragen, warum dort die vielen kleinen Häuser wie Hundehütten über den Gräbern stehen. Früher habe man in Chiapas die Toten im Hause begraben, im Lehmboden unter dem Wohnraum. Das hätten die spanischen Missionare aber verboten, das war denen ein zu deutlich unchristlicher Ahnenkult. Also baue man jetzt die Häuser über die Toten, damit die keinen Grund hätten sich zu beschweren, dass sie falsch beerdigt worden seien.
Am N achmittag, oben in der Stadt San Cristobal, zwischen Rucksacktouristen mit Joints, edel gekleideten Bergwanderern mit Zigarre, zwischen den Indiofrauen, die auf der Straße hockend allerlei Tand anbieten und den teuren Boutiquen und Weinläden, finden wir noch die Sensation des Monats (Januar): Unter einem großen weißen Plastikzelt vor der Kathedrale hat man eine Eisbahn aufgebaut, Indios lernen Schlittschuh laufen, begeistertes Rumrutschen, großes Gelächter.
achmittag, oben in der Stadt San Cristobal, zwischen Rucksacktouristen mit Joints, edel gekleideten Bergwanderern mit Zigarre, zwischen den Indiofrauen, die auf der Straße hockend allerlei Tand anbieten und den teuren Boutiquen und Weinläden, finden wir noch die Sensation des Monats (Januar): Unter einem großen weißen Plastikzelt vor der Kathedrale hat man eine Eisbahn aufgebaut, Indios lernen Schlittschuh laufen, begeistertes Rumrutschen, großes Gelächter.
PALENQUE
 Morgens früh geht es nach Palenque, die Berge runter, Richtung Golf von Mexiko, in den Urwald, wird eine lange Fahrt. Der Tag zieht auf, dichte Nebelschwaden über den Hochtälern, tropfend feuchtes Baumdickicht, fröstelnde Bergbauern vor seltenen Hütten, gefräßiges Grün bis zum Horizont. Hier und da hocken Soldaten in Baumhäusern, das sehen wir sonst nie, die ‚Wilden‘ Chiapas werden bewacht. Zwischenstopp bei Aqua Azul, dem ‚Blauen Wasserfall‘. Breit, fast gemächlich fällt das Wasser über Klippen. Drumherum ein zu großer Rummel von Souvenirbuden und Schnellrestaurants. Aber vor gut 10 Jahren, als das noch nicht so war, wurden hier Touristenbusse auch mal überfallen. Bald schmeckt es wieder, fast alle essen das Übliche: Tacos, dunkle Bohnenpaste, scharfe Soße, Tomate, rote Zwiebeln, Stück Fleisch. Das schmeckt öfter, als man denkt, aber dann irgendwann nicht mehr, man will dann was anderes, das aber gibt’s selten. Hier ja, ganze Flussfische, fast zu trockenen Fisch-Keksen zu lange gegrillt, aber mit viel Knoblauch.
Morgens früh geht es nach Palenque, die Berge runter, Richtung Golf von Mexiko, in den Urwald, wird eine lange Fahrt. Der Tag zieht auf, dichte Nebelschwaden über den Hochtälern, tropfend feuchtes Baumdickicht, fröstelnde Bergbauern vor seltenen Hütten, gefräßiges Grün bis zum Horizont. Hier und da hocken Soldaten in Baumhäusern, das sehen wir sonst nie, die ‚Wilden‘ Chiapas werden bewacht. Zwischenstopp bei Aqua Azul, dem ‚Blauen Wasserfall‘. Breit, fast gemächlich fällt das Wasser über Klippen. Drumherum ein zu großer Rummel von Souvenirbuden und Schnellrestaurants. Aber vor gut 10 Jahren, als das noch nicht so war, wurden hier Touristenbusse auch mal überfallen. Bald schmeckt es wieder, fast alle essen das Übliche: Tacos, dunkle Bohnenpaste, scharfe Soße, Tomate, rote Zwiebeln, Stück Fleisch. Das schmeckt öfter, als man denkt, aber dann irgendwann nicht mehr, man will dann was anderes, das aber gibt’s selten. Hier ja, ganze Flussfische, fast zu trockenen Fisch-Keksen zu lange gegrillt, aber mit viel Knoblauch.
 Am Nachmittag endlich die Tempelanlagen von Palenque, erhabene Maya-Ruinen im Urwald, schöner als alle anderen Ruinen bisher. Zwei Stunden Rundgang und die reichen kaum, schon auf der ersten Pyramide hat uns ein heiliger Schrecken gepackt: ein tiefes Gebrüll aus hundert Kehlen, im Urwald um uns herum die Brüllaffen, unvorstellbar laut und klagend, gruselig ihr ständig an- und abschwellender Drohgesang. Unser Tour-Guide behauptet, die Affen würden ihren einzigen Feind dort draußen, den Jaguar, nachahmen, um den zu erschrecken. Stimmt nicht, die Affen markieren so ihr Territorium. Die paar hundert Leute, die im Park unterwegs sind, jedenfalls erschreckt das gewaltig, am Ausgang stehen dann alle nochmal dicht beisammen und starren in den tiefen unergründlichen Urwald vor ihnen.
Am Nachmittag endlich die Tempelanlagen von Palenque, erhabene Maya-Ruinen im Urwald, schöner als alle anderen Ruinen bisher. Zwei Stunden Rundgang und die reichen kaum, schon auf der ersten Pyramide hat uns ein heiliger Schrecken gepackt: ein tiefes Gebrüll aus hundert Kehlen, im Urwald um uns herum die Brüllaffen, unvorstellbar laut und klagend, gruselig ihr ständig an- und abschwellender Drohgesang. Unser Tour-Guide behauptet, die Affen würden ihren einzigen Feind dort draußen, den Jaguar, nachahmen, um den zu erschrecken. Stimmt nicht, die Affen markieren so ihr Territorium. Die paar hundert Leute, die im Park unterwegs sind, jedenfalls erschreckt das gewaltig, am Ausgang stehen dann alle nochmal dicht beisammen und starren in den tiefen unergründlichen Urwald vor ihnen.
 Am nächsten Tag wieder Expedition: entlang der Grenze nach Guatemala geht es zwei Stunden mit dem Bus, dann eine gute Stunde mit dem Long-Boat auf dem Usumacinta-Fluss in den Dschungel am Arsch der Welt, nach Yaxchilán – dass wir da hin wollten hat schon die Reisevermittler in Deutschland erschreckt. Eine versunkene Maya-Stadt im Niemandsland und deshalb unerreichbar für tanzende Rentner und Playback-Gesinge. Unterwegs – viel Zeit – lässt der aktuelle Tour-Guide tief blicken, schildert, wie hier die Leute abgezockt werden, wenn sie versuchen auf eigene Faust solche Touren zu machen und beschönigt sonst allerhand. Ich habe gelesen, dass auf dieser verlassenen Strecke früher so gut wie jeder Bus geentert und abkassiert wurde. Kann man sich gut vorstellen, die armen Typen, die da am Wegesrand leben sehen die Kohle, die ihnen bitter fehlt, alltäglich vor ihrer Tür vorbeischaukeln. Als ich einen zu grüßen versuche – schwachsinniger Einfall der üblichen touristischen Leutseligkeit – macht der eine eindeutige Geste: die Hand streift über die Kehle. Das habe ganz andere Gründe, wird sogleich versichert, hier sei Schmuggler-Land, für die Überfälle früher seien immer die Gesetzlosen aus Guatemala verantwortlich gewesen, die Mexikaner hier seien gut gelaunt, ein Witz sei das gewesen. Kann sein, dass es denen Spaß macht, die vorbeidonnernden Touristen zu verängstigen, klappt aber auch zuverlässig.
Am nächsten Tag wieder Expedition: entlang der Grenze nach Guatemala geht es zwei Stunden mit dem Bus, dann eine gute Stunde mit dem Long-Boat auf dem Usumacinta-Fluss in den Dschungel am Arsch der Welt, nach Yaxchilán – dass wir da hin wollten hat schon die Reisevermittler in Deutschland erschreckt. Eine versunkene Maya-Stadt im Niemandsland und deshalb unerreichbar für tanzende Rentner und Playback-Gesinge. Unterwegs – viel Zeit – lässt der aktuelle Tour-Guide tief blicken, schildert, wie hier die Leute abgezockt werden, wenn sie versuchen auf eigene Faust solche Touren zu machen und beschönigt sonst allerhand. Ich habe gelesen, dass auf dieser verlassenen Strecke früher so gut wie jeder Bus geentert und abkassiert wurde. Kann man sich gut vorstellen, die armen Typen, die da am Wegesrand leben sehen die Kohle, die ihnen bitter fehlt, alltäglich vor ihrer Tür vorbeischaukeln. Als ich einen zu grüßen versuche – schwachsinniger Einfall der üblichen touristischen Leutseligkeit – macht der eine eindeutige Geste: die Hand streift über die Kehle. Das habe ganz andere Gründe, wird sogleich versichert, hier sei Schmuggler-Land, für die Überfälle früher seien immer die Gesetzlosen aus Guatemala verantwortlich gewesen, die Mexikaner hier seien gut gelaunt, ein Witz sei das gewesen. Kann sein, dass es denen Spaß macht, die vorbeidonnernden Touristen zu verängstigen, klappt aber auch zuverlässig.
 Bei Ankunft runter zum sehr breiten, sehr lehmfarbenen Fluss, Longboote besteigen, 4, 6 Leute jeweils, dann zügig flussaufwärts. Rechts Guatemala, links der Zipfel von
Bei Ankunft runter zum sehr breiten, sehr lehmfarbenen Fluss, Longboote besteigen, 4, 6 Leute jeweils, dann zügig flussaufwärts. Rechts Guatemala, links der Zipfel von
Mexiko, auf dem wir gekommen sind. Jetzt hören wir sie, die Schauer-Geschichten von Schmugglern und Dieben (harmlos) und Drogen und Mördern, die aus Guatemala über den Fluss kommen und für das massive Bedrohen, Überfallen, Beklauen auch der Touristen verantwortlich gewesen seien, jahrelang. Früher, jetzt sei alles befriedet. Militär sehen wir nirgends, das ist selten an der Grenze. Roadblocks aber gibt es auch hier, man möchte gar nicht auf eigene Faust hier unterwegs sein, schutzlos allein im Mietwagen oder gar zu Fuß per Anhalter. Aber auch so was sehen wir, Traveller sind hemmungslos.
 Nach einer guten Stunde Highspeed sind wir da, in einer mächtigen, eleganten Flussschleife liegt Yaxchilán, die verschwiegenste alle Maya-Ruinen. Das ist noch eindrucksvoller als es schon Palenque war, und doch, man vermisst die Affen, das Gebrüll, die gefühlte Wildnis. Für eine so lange Anfahrt ist das alles hier fast ein wenig zu lauschig, zu gemütlich. Aber unsagbar schön, wie der Urwald nur hier und da die Sonne durchlässt und die auf die Reste enormer Bauten scheint, hier lebten mal viele Menschen. Was für welche ? Davon erfahren wir wenig, nur dass sie ein brutales Klassensystem hatten, in dem, stärker noch als heute vorstellbar (?) das Leben nur für die ganz oben gut war. Wir sind wenige und freudig erregt und weil die Anforderungen an Dschungel-Abenteuer gering sind, passiert sogleich das, was immer passiert in den Ruinen Mexikos: alle klettern stöhnend, hüpfend, schwitzend, krauchend oder triumphierend leichtfüßig hoch auf die höchste aller Pyramiden um dann japsend gemeinsam runter zu schauen.
Nach einer guten Stunde Highspeed sind wir da, in einer mächtigen, eleganten Flussschleife liegt Yaxchilán, die verschwiegenste alle Maya-Ruinen. Das ist noch eindrucksvoller als es schon Palenque war, und doch, man vermisst die Affen, das Gebrüll, die gefühlte Wildnis. Für eine so lange Anfahrt ist das alles hier fast ein wenig zu lauschig, zu gemütlich. Aber unsagbar schön, wie der Urwald nur hier und da die Sonne durchlässt und die auf die Reste enormer Bauten scheint, hier lebten mal viele Menschen. Was für welche ? Davon erfahren wir wenig, nur dass sie ein brutales Klassensystem hatten, in dem, stärker noch als heute vorstellbar (?) das Leben nur für die ganz oben gut war. Wir sind wenige und freudig erregt und weil die Anforderungen an Dschungel-Abenteuer gering sind, passiert sogleich das, was immer passiert in den Ruinen Mexikos: alle klettern stöhnend, hüpfend, schwitzend, krauchend oder triumphierend leichtfüßig hoch auf die höchste aller Pyramiden um dann japsend gemeinsam runter zu schauen.  Bei der Rückfahrt liegen Krokodile mit so fetten Bäuchen am Ufer, so fett, dass man mindestens Ziegen darin vermutet. Das sei nicht nötig, der Fluss sei geradezu überbevölkert mit Fischen, wegen der Grenze fischen hier Menschen zu selten, Krokodile immer. An der Anlegestelle gibt’s für uns wieder Hühnchen mit Fritten und Salsa, was sonst. Die Rückfahrt in beginnender Dunkelheit dauert wie immer zu lange.
Bei der Rückfahrt liegen Krokodile mit so fetten Bäuchen am Ufer, so fett, dass man mindestens Ziegen darin vermutet. Das sei nicht nötig, der Fluss sei geradezu überbevölkert mit Fischen, wegen der Grenze fischen hier Menschen zu selten, Krokodile immer. An der Anlegestelle gibt’s für uns wieder Hühnchen mit Fritten und Salsa, was sonst. Die Rückfahrt in beginnender Dunkelheit dauert wie immer zu lange.
Abends flüchten wir vom Touristenhotel Mision Palenque in die Stadt, die aber gibt’s gar nicht, die ‚Stadt‘ Palenque ist eine ausgedachte Ansammlung von Billigläden, Andenkenshops, Resterampen. Irgendwo essen wir Klebriges, irgendwo kaufen wir Kaffee, ab morgen wir es keinen Chiapas-Kaffee mehr geben. Als wir endlich im Hotel landen, ist der toupierte Schmalzsänger längst gegangen, die Rentner haben das Büffet leergefressen und schlafen, wir sind mit den Resten zufrieden, es herrscht Ruhe, ins Bett.
Busfahren ist bequem in Mexiko, wenn man sich den 1. Klasse-Bus leistet, der ist noch immer deutlich billiger ist als jede lange Busfahrt hier. Reservierte Plätze, Klo, Kaffeepausen, eine immer etwas zu kalte Klimaanlage und so wichtig fürs Gefühl: Gepäckscheine, alles ist diebstahlsicher verstaut (wie fast überall in Südamerika auf den teureren Bussen). Jetzt, und den Rest der Reise seit Tuxla Gutierres fahren wir Bus, das soll hier sicher sein, was nicht überall der Fall ist. Der Trick: die Übeltäter kaufen sich eine Fahrkarte und sitzen mit im Bus, bevor sie die Knarren zücken und alle ausnehmen. Kein Tourist, kein Touristenführer, der nicht Schauergeschichten wie diese auf Lager hat und sehr gern erzählt. Erlebt haben wir nichts davon. Aber, so denkt man unwillkürlich, wenn’s was zu erbeuten gibt, dann in diesen Bussen, da sitzen die wohlsituierten Touristen, für ‚das Volk‘ sind diese preiswerten Luxusbusse nicht billig genug. Aber vielleicht werden ja die wenigen mexikanischen Passagiere besonders kritisch in Augenschein genommen, gefilzt sogar ? Wir fühlen uns sicher.
CAMPECHE
 Sehr früh morgens sitzen wir wieder im Bus, nach Campeche am Golf von Mexiko, Zwischenhalt nach Merida, der ‚weißen Perle der Karibik‘. Das Weltkulturerbe Campeche, ich mache es kurz, ist eine Enttäuschung. Die Stadt, die sich wegen der Überfälle von Piraten hinter mächtigen Stadtmauern verschanzt hat, liegt nicht am Wasser, oder doch, aber: die Stadt ist getrennt von der Küste durch eine achtspurige Durchgangsstraße, kein Mensch würde da am Ufer flanieren, die Unsinnigkeit solcher Planung erinnert wieder an die DDR, die beidseits der Straße hingeklatschten Betonplatten-Bauten lassen keine andere Assoziation zu. Drinnen, am zentralen Platz aber, in der ersten Etage über den Arkaden, da geht’s dann doch prächtig, der Frozen Margarita wird nach Meckern unsererseits kräftig aufgetunt, wir sind schnell angeheitert und trinken weiter.
Sehr früh morgens sitzen wir wieder im Bus, nach Campeche am Golf von Mexiko, Zwischenhalt nach Merida, der ‚weißen Perle der Karibik‘. Das Weltkulturerbe Campeche, ich mache es kurz, ist eine Enttäuschung. Die Stadt, die sich wegen der Überfälle von Piraten hinter mächtigen Stadtmauern verschanzt hat, liegt nicht am Wasser, oder doch, aber: die Stadt ist getrennt von der Küste durch eine achtspurige Durchgangsstraße, kein Mensch würde da am Ufer flanieren, die Unsinnigkeit solcher Planung erinnert wieder an die DDR, die beidseits der Straße hingeklatschten Betonplatten-Bauten lassen keine andere Assoziation zu. Drinnen, am zentralen Platz aber, in der ersten Etage über den Arkaden, da geht’s dann doch prächtig, der Frozen Margarita wird nach Meckern unsererseits kräftig aufgetunt, wir sind schnell angeheitert und trinken weiter.  Abends stolpern wir durch die ganz hübsche Innenstadt auf der Suche nach einem Geheimtipp-Restaurant, (kein Reisender ohne so was aus dem Internet). Das Lokal finden wir nach endlosem Suchen, ist auch erleuchtet, aber ein Kellner, der herausgeeilt kommt, verkündet es sei geschlossen. So schön, dass man versuchen würde, sich Zutritt mit Gewalt zu verschaffen, sieht es nun doch nicht aus. Wir tapern zurück, machen Nachtfotos von dem vielen Kunstgewerbe, mit dem die Stadt möbliert ist und haben doch noch ein freudiges Erlebnis. Auf einem von wenigen Tiefstrahlern beleuchteten Parkplatz spielen sehr viele ältliche Mexikaner an kleinen Plastiktischen so was wie Bingo. Die Stimmung ist übermütig, gern lassen sie sich fotografieren, erklären sogar rasend schnell auf Spanisch das Spiel, wir glotzen hilflos zurück und werden jovial bejubelt. In einem nach typischem Touristen-Nepp aussehenden Fresslokal (Restaurante Marganzo), plastikverhüllte Fotos der angebotenen Speisen liegen vor dem Laden aus, ist das Essen ganz vorzüglich, wir sind versöhnt. Auf dem Rückweg posieren wir auf einem Sockel in den Armen eines überlebensgroßen Bronze-Erz-Engels für Fotos, wir sind nicht die Einzigen.
Abends stolpern wir durch die ganz hübsche Innenstadt auf der Suche nach einem Geheimtipp-Restaurant, (kein Reisender ohne so was aus dem Internet). Das Lokal finden wir nach endlosem Suchen, ist auch erleuchtet, aber ein Kellner, der herausgeeilt kommt, verkündet es sei geschlossen. So schön, dass man versuchen würde, sich Zutritt mit Gewalt zu verschaffen, sieht es nun doch nicht aus. Wir tapern zurück, machen Nachtfotos von dem vielen Kunstgewerbe, mit dem die Stadt möbliert ist und haben doch noch ein freudiges Erlebnis. Auf einem von wenigen Tiefstrahlern beleuchteten Parkplatz spielen sehr viele ältliche Mexikaner an kleinen Plastiktischen so was wie Bingo. Die Stimmung ist übermütig, gern lassen sie sich fotografieren, erklären sogar rasend schnell auf Spanisch das Spiel, wir glotzen hilflos zurück und werden jovial bejubelt. In einem nach typischem Touristen-Nepp aussehenden Fresslokal (Restaurante Marganzo), plastikverhüllte Fotos der angebotenen Speisen liegen vor dem Laden aus, ist das Essen ganz vorzüglich, wir sind versöhnt. Auf dem Rückweg posieren wir auf einem Sockel in den Armen eines überlebensgroßen Bronze-Erz-Engels für Fotos, wir sind nicht die Einzigen.
 Am nächsten Morgen ist noch Zeit, das Weltkulturerbe auf seine Quintessenz hin zu untersuchen. Es sind die wunderbar pastellig gestrichenen einstöckigen Häuser in den weniger belebten Vierteln der Stadt. Rosé, lindgrün, himmelbau, hühnerkacke- ocker, limonengelb, jede Farbe kommt vor, wunderschön. Dahinter allerdings bröckelt es deutlich, die ehemals reiche kleine Stadt scheint auf dem absteigenden Ast. Irgendwann hier hatten wir noch eine Besonderheit besucht: in einer Kirche ist der Heiland über dem Altar schwarz. Was sich der kritische Geist sogleich als einen allzu durchschaubaren Trick erklären, die dunkelhäutigen Ureinwohner für die Kirche zu gewinnen, wird anders begründet. Es sei das Holz, das habe die Eigenart heftig nachzudunkeln, Zeit dafür hatte es ja genug.
Am nächsten Morgen ist noch Zeit, das Weltkulturerbe auf seine Quintessenz hin zu untersuchen. Es sind die wunderbar pastellig gestrichenen einstöckigen Häuser in den weniger belebten Vierteln der Stadt. Rosé, lindgrün, himmelbau, hühnerkacke- ocker, limonengelb, jede Farbe kommt vor, wunderschön. Dahinter allerdings bröckelt es deutlich, die ehemals reiche kleine Stadt scheint auf dem absteigenden Ast. Irgendwann hier hatten wir noch eine Besonderheit besucht: in einer Kirche ist der Heiland über dem Altar schwarz. Was sich der kritische Geist sogleich als einen allzu durchschaubaren Trick erklären, die dunkelhäutigen Ureinwohner für die Kirche zu gewinnen, wird anders begründet. Es sei das Holz, das habe die Eigenart heftig nachzudunkeln, Zeit dafür hatte es ja genug.
MERIDA
 Am späten Nachmittag, nach wieder längerer Busfahrt, nach mehreren Roadblocks und leichtem Dissens mit dem Busfahrer, der wieder und wieder seine Jacke vor unsere Nase hängt, weil er gar nicht auf die Idee kommt, dass jemand bei dieser langweiligen Tour auf die Straße rausblicken möchte – am späten Nachmittag sind wir in Merida. Hier werden wir wieder tun, was wir auf Reisen gelernt haben: lange bleiben, etwas zu lange bleiben. Wenn dann nach Tagen die Hektik raus ist, das Abklappern der Sehenswürdigkeiten vorüber, wenn man plötzlich im Bett liegen oder auf dem Balkon sitzen bleibt, dann ist ein ganz anderer Genuss möglich, wissen wir.
Am späten Nachmittag, nach wieder längerer Busfahrt, nach mehreren Roadblocks und leichtem Dissens mit dem Busfahrer, der wieder und wieder seine Jacke vor unsere Nase hängt, weil er gar nicht auf die Idee kommt, dass jemand bei dieser langweiligen Tour auf die Straße rausblicken möchte – am späten Nachmittag sind wir in Merida. Hier werden wir wieder tun, was wir auf Reisen gelernt haben: lange bleiben, etwas zu lange bleiben. Wenn dann nach Tagen die Hektik raus ist, das Abklappern der Sehenswürdigkeiten vorüber, wenn man plötzlich im Bett liegen oder auf dem Balkon sitzen bleibt, dann ist ein ganz anderer Genuss möglich, wissen wir.  Hier in Merida hilft zweierlei: unser Hotel ist das schönste der Reise, die ‚Casa Lecanda‘ ist traumhaft edelgroßbürgerlich, Innenhof an Innenhof, riesige Räume, Balkon, Blick über Palmen, gediegene Stille. Zu Fuß in die Stadt sind’s zehn Minuten. Und die Stadt hat’s auch, fast Oaxaca-ähnlich, wären da nicht doch wieder die eher zahlreichen Touristen, viele davon Amerikaner, ältere Jahrgänge. Merida liegt nicht weit vom Golf, Florida ist kaum entfernter als die Hauptstadt, das merkt man. Es gibt auffallend viele Immobilien zu kaufen, angepriesen in Englisch, hier siedelt offenbar der Ami, dem Florida zu ausgelatscht oder zu teuer ist.
Hier in Merida hilft zweierlei: unser Hotel ist das schönste der Reise, die ‚Casa Lecanda‘ ist traumhaft edelgroßbürgerlich, Innenhof an Innenhof, riesige Räume, Balkon, Blick über Palmen, gediegene Stille. Zu Fuß in die Stadt sind’s zehn Minuten. Und die Stadt hat’s auch, fast Oaxaca-ähnlich, wären da nicht doch wieder die eher zahlreichen Touristen, viele davon Amerikaner, ältere Jahrgänge. Merida liegt nicht weit vom Golf, Florida ist kaum entfernter als die Hauptstadt, das merkt man. Es gibt auffallend viele Immobilien zu kaufen, angepriesen in Englisch, hier siedelt offenbar der Ami, dem Florida zu ausgelatscht oder zu teuer ist.  Die Stadt um dem Zocalo aber ist ganz mexikanisch. Da auch, am Hauptplatz findet statt, was uns verlockt hat. Sonntags ist die Stadt autofrei und man tanzt – so einfach sind Attraktionen machbar. Hier kleidet man sich tropisch, weiß und Leinen, Spitzenkleidchen, Strohhut ‚JipiJapa‘, die hiesige Variante des Panamahuts. Die kleine Stadt Bécal in der alles, was nur einen Finger bewegen kann, den zum Hut-Weben nutzt, haben wir knapp verpasst. Und jetzt ist das Bleiben, das Verharren zu schön um die erforderliche Stunde bis Bécal noch hin und her zu fahren. Wir kaufen unseren JipiJapa hier, die Preise bewegen sich zwischen 5 € und 300 €, die Qualität hat ähnliche Bandbreite, das merken wir erst später. Wir kaufen was Billiges und tragen’s bis es (schnell) unansehnlich wird.
Die Stadt um dem Zocalo aber ist ganz mexikanisch. Da auch, am Hauptplatz findet statt, was uns verlockt hat. Sonntags ist die Stadt autofrei und man tanzt – so einfach sind Attraktionen machbar. Hier kleidet man sich tropisch, weiß und Leinen, Spitzenkleidchen, Strohhut ‚JipiJapa‘, die hiesige Variante des Panamahuts. Die kleine Stadt Bécal in der alles, was nur einen Finger bewegen kann, den zum Hut-Weben nutzt, haben wir knapp verpasst. Und jetzt ist das Bleiben, das Verharren zu schön um die erforderliche Stunde bis Bécal noch hin und her zu fahren. Wir kaufen unseren JipiJapa hier, die Preise bewegen sich zwischen 5 € und 300 €, die Qualität hat ähnliche Bandbreite, das merken wir erst später. Wir kaufen was Billiges und tragen’s bis es (schnell) unansehnlich wird.  Nichts schöner, als abends, wenn’s weniger heiß ist, in die Stadt zu gehen, hier ist viel los, und das offenbar nicht wegen uns, den Touristen. Im riesigen Stadttheater vor knackend vollem Saal, Eintritt frei, es ist Freitag, toben Mariachi-Formationen über die Bühne, dann kommen Timbales und Marimba, es wird schmalzig karibisch mild, die Menge grunzt wohlig. Vielleicht ist die Gastronomie hier etwas zu angepasst, das Essen hier etwas zu amerikanisch, die zum Kauf stehenden Immobilien außerhalb der Altstadt etwas zu dominierend, drinnen, im Kern der Stadt behaupten sich die, die hier immer schon waren. Am Sonntag endlich der Festtag, wir sitzen zwischen Tausenden am Straßenrand des großen Platzes und erleben mexikanische Stand-Up-Comedy der allergröbsten Sorte, verstehen kein Wort, amüsieren uns haltlos und werden wohlwollend bestaunt. Nur wegducken muss man sich schnell, wenn die Künstler sich nähern, einen Gringo so richtig vollfett der Menge vorzuführen, das scheint ein Bedürfnis der Komiker. Wir kucken weg, standhaft.
Nichts schöner, als abends, wenn’s weniger heiß ist, in die Stadt zu gehen, hier ist viel los, und das offenbar nicht wegen uns, den Touristen. Im riesigen Stadttheater vor knackend vollem Saal, Eintritt frei, es ist Freitag, toben Mariachi-Formationen über die Bühne, dann kommen Timbales und Marimba, es wird schmalzig karibisch mild, die Menge grunzt wohlig. Vielleicht ist die Gastronomie hier etwas zu angepasst, das Essen hier etwas zu amerikanisch, die zum Kauf stehenden Immobilien außerhalb der Altstadt etwas zu dominierend, drinnen, im Kern der Stadt behaupten sich die, die hier immer schon waren. Am Sonntag endlich der Festtag, wir sitzen zwischen Tausenden am Straßenrand des großen Platzes und erleben mexikanische Stand-Up-Comedy der allergröbsten Sorte, verstehen kein Wort, amüsieren uns haltlos und werden wohlwollend bestaunt. Nur wegducken muss man sich schnell, wenn die Künstler sich nähern, einen Gringo so richtig vollfett der Menge vorzuführen, das scheint ein Bedürfnis der Komiker. Wir kucken weg, standhaft.
 Dann gibt’s doch noch eine Tour, von Deutschland bereits gebucht: auf eine Hazienda, es ist die letzte, auf der noch Sisalstricke aus Agaven hergestellt wird, mit der Erfindung der Plastiktaue ging’s bergab, vorher waren die Sisal-Fürsten die Elite dieses Landstrichs. Wir besuchen ein imponierendes Herrenhaus mitten in der Pampa, dann wirft man offenbar nur für die Besucher noch mal die alten dampfgetriebenen Maschinen an, Klasse. Die Faser wird aus den Blättern gepresst, gequetscht, getrocknet, gekämmt (!) und geflochten. Wir sind beeindruckt, auch wenn’s nur ein Schau-Arbeiten ist.
Dann gibt’s doch noch eine Tour, von Deutschland bereits gebucht: auf eine Hazienda, es ist die letzte, auf der noch Sisalstricke aus Agaven hergestellt wird, mit der Erfindung der Plastiktaue ging’s bergab, vorher waren die Sisal-Fürsten die Elite dieses Landstrichs. Wir besuchen ein imponierendes Herrenhaus mitten in der Pampa, dann wirft man offenbar nur für die Besucher noch mal die alten dampfgetriebenen Maschinen an, Klasse. Die Faser wird aus den Blättern gepresst, gequetscht, getrocknet, gekämmt (!) und geflochten. Wir sind beeindruckt, auch wenn’s nur ein Schau-Arbeiten ist.  Dann geht es per Pferdekutsche auf Schienen durch die Plantage, endlose Agavenfelder, bis wir schließlich in einer Strohhütte landen, bei einem uralten Sisalarbeiter, der nur für uns noch mal das alte Zeug angezogen hat und erzählt. Fast zahnlos aber mit glühendem Blick spricht er von vergangener Knechtschaft, wir verstehen kein Wort und sind ergriffen. Am Herrenhaus im Souterrain hatten wir bereits Verliese gesehen, deren Nutzen uns unklar war. Sie dienten der Züchtigung der indigenen Arbeitssklaven, die wurden dort eingesperrt und an Wandhaken gekettet, wenn sie nicht gehorchten.
Dann geht es per Pferdekutsche auf Schienen durch die Plantage, endlose Agavenfelder, bis wir schließlich in einer Strohhütte landen, bei einem uralten Sisalarbeiter, der nur für uns noch mal das alte Zeug angezogen hat und erzählt. Fast zahnlos aber mit glühendem Blick spricht er von vergangener Knechtschaft, wir verstehen kein Wort und sind ergriffen. Am Herrenhaus im Souterrain hatten wir bereits Verliese gesehen, deren Nutzen uns unklar war. Sie dienten der Züchtigung der indigenen Arbeitssklaven, die wurden dort eingesperrt und an Wandhaken gekettet, wenn sie nicht gehorchten.
 Doch war das Ende des Sisals für die Indios auch kein Segen, jetzt haben viele gar keine Arbeit mehr. Die Barone sind weg und verhökern ihre pompösen Stadthäuser an solvente Ami-Rentner, der Wohlstand der Region schwindet. Der Tanz auf dem Zocalo, ein Tanz auf dem Vulkan ? Dies Gefühl hat man nicht, die Lebensfreude scheint haltbar.
Doch war das Ende des Sisals für die Indios auch kein Segen, jetzt haben viele gar keine Arbeit mehr. Die Barone sind weg und verhökern ihre pompösen Stadthäuser an solvente Ami-Rentner, der Wohlstand der Region schwindet. Der Tanz auf dem Zocalo, ein Tanz auf dem Vulkan ? Dies Gefühl hat man nicht, die Lebensfreude scheint haltbar.
Eines Abends auf dem späten Rückweg in unsere etwas entlegene Edelherberge treffen wir noch auf ein Vorstadt-Fest. Man verkauft allerlei Handwerkliches, grauenhafte Püppchen und Schnitzereien, Kettchen und Ohrringe. Dazwischen steht einer einfach mit einem Teleskop und eine Menge drängt sich für ein paar Pesos den Vollmond zu untersuchen. Daneben eine echte Pappmaché-Bühne, eine dörfliche Szene ist darauf gemalt, davor Stuhlreihen mit aufmerksamen Zuhörern. Wieder macht einer grobe Scherze, wieder hebt eine ältere Schönheit ein wenig den Rock, aber dann.  Die Bühne betritt ein kleiner fetter Mann, in schwarz mit roter Schärpe, speckiger Haarlocke. Das Playback erklingt und er schmettert in den allerschönsten Tönen (will mir scheinen) eine Arie nach der anderen. Madame dreht sich weg, will nach Hause. Aber ich kann mich nicht trennen, ich sehe wie der kleine Mann sich in die Brust wirft, mit großen Gesten ganz den Pavarotti gibt und schmelze dahin. Da steht er und hat die paar Minuten, nach denen er ein Leben lang trachtet. Er schmettert und schwitzt und posiert und ich sehe ihn, wie er nachmittags vor dem Spiegel sich vorbereitet, wie er viel zu selten was zum Singen findet, wie er auf Hochzeiten und Begräbnissen seine Kicks holen muss, wie er in den Kneipen belächelt wird, wenn er anhebt zu singen, nur weil ihn keiner daran hindert und wie das hier und jetzt für ihn das Allergrößte sein muss. Kann er singen ? Was spielt das für eine Rolle, er will singen und er darf singen und alle erstarren vor Achtung und jubeln dann laut und es hat sich für ihn gelohnt, mal wieder, wie zu selten. Würden sie bei uns so jemand niederbrüllen ? Vielleicht nicht, hier keinesfalls.
Die Bühne betritt ein kleiner fetter Mann, in schwarz mit roter Schärpe, speckiger Haarlocke. Das Playback erklingt und er schmettert in den allerschönsten Tönen (will mir scheinen) eine Arie nach der anderen. Madame dreht sich weg, will nach Hause. Aber ich kann mich nicht trennen, ich sehe wie der kleine Mann sich in die Brust wirft, mit großen Gesten ganz den Pavarotti gibt und schmelze dahin. Da steht er und hat die paar Minuten, nach denen er ein Leben lang trachtet. Er schmettert und schwitzt und posiert und ich sehe ihn, wie er nachmittags vor dem Spiegel sich vorbereitet, wie er viel zu selten was zum Singen findet, wie er auf Hochzeiten und Begräbnissen seine Kicks holen muss, wie er in den Kneipen belächelt wird, wenn er anhebt zu singen, nur weil ihn keiner daran hindert und wie das hier und jetzt für ihn das Allergrößte sein muss. Kann er singen ? Was spielt das für eine Rolle, er will singen und er darf singen und alle erstarren vor Achtung und jubeln dann laut und es hat sich für ihn gelohnt, mal wieder, wie zu selten. Würden sie bei uns so jemand niederbrüllen ? Vielleicht nicht, hier keinesfalls.
 Am letzten Nachmittag lockt uns der schiere Andrang vor dem riesigen Stadttheater so heftig, dass wir uns (sehr billige) Karten kaufen und reinsetzen. Das Haus summt und brummt voll aufgeregten Kindern, alle verkleidet, Vorkarnevalsfeier, einige Zwölfjährige sind für unsere Augen fast zu sexy ausstaffiert, Pappi hält schützende Hand über sie. Dann geht es los, auf der Bühne, jeder gibt was zum Besten, alles wird
Am letzten Nachmittag lockt uns der schiere Andrang vor dem riesigen Stadttheater so heftig, dass wir uns (sehr billige) Karten kaufen und reinsetzen. Das Haus summt und brummt voll aufgeregten Kindern, alle verkleidet, Vorkarnevalsfeier, einige Zwölfjährige sind für unsere Augen fast zu sexy ausstaffiert, Pappi hält schützende Hand über sie. Dann geht es los, auf der Bühne, jeder gibt was zum Besten, alles wird
bejubelt. Ganz besonders ’nachhaltig‘ ist die Begeisterung bei der Darbietung einiger behinderter Kinder, die ungelenk tanzen, rezitieren, posieren. Das erinnert mich an die Hochachtung, mit der man in Oaxaca den nervtötend laut prustenden alten Mann mit der abgesägten Posaune behandelt hat. Von den Mexikanern lässt sich was lernen. Morgen fahren wir ‚in die Ferien‘, nur noch gepflegte Langeweile am Strand, an der mexikanischen Riviera, am Atlantik, außerhalb des Golfs. Nach Tulum.
TULUM
 Yucatan ist so flach wie Nordfriesland und ebenso abwechslungslos. Alle im Bus pennen hinter zugezogenen Vorhängen, wir nicht. Wir registrieren noch jeden Busch begrübeln die Roadblocks, hier sind sie noch zahlreicher, viel Polizei und Militär auf den Straßen, Yucatan ist eine Art Heiligtum des Tourismus für die Mexikaner, hier darf ganz und gar nichts schief gehen. Zwischen stundenlangem hüfthohem Gebüsch hier und da ein Hinweis auf ‚Cenotes‘, das sind riesige unterirdische Wasser-Verbindungen und Seen (Süßwasser) die halb Yucatan unterhöhlen, erforscht sind sie noch lange nicht alle, manche sind ausgebaut für Spaßtaucher. Nix für uns. Tulum (town) ist ein trostloses Straßennest, nicht ganz so traurig und synthetisch wie Palenque (town), aber nah dran.
Yucatan ist so flach wie Nordfriesland und ebenso abwechslungslos. Alle im Bus pennen hinter zugezogenen Vorhängen, wir nicht. Wir registrieren noch jeden Busch begrübeln die Roadblocks, hier sind sie noch zahlreicher, viel Polizei und Militär auf den Straßen, Yucatan ist eine Art Heiligtum des Tourismus für die Mexikaner, hier darf ganz und gar nichts schief gehen. Zwischen stundenlangem hüfthohem Gebüsch hier und da ein Hinweis auf ‚Cenotes‘, das sind riesige unterirdische Wasser-Verbindungen und Seen (Süßwasser) die halb Yucatan unterhöhlen, erforscht sind sie noch lange nicht alle, manche sind ausgebaut für Spaßtaucher. Nix für uns. Tulum (town) ist ein trostloses Straßennest, nicht ganz so traurig und synthetisch wie Palenque (town), aber nah dran.  Immerhin ist hier wie dort eine Goldquelle in der Nähe, das merkt man, in Palenque sind es die hinreißenden Dschungel-Ruinen, hier der Strand, der Strand von Tulum ist der beste in ganz Mexiko (?!). Jedenfalls sind die Taxifahrer sich einig im Kassieren der viel zu hohen Pauschalpreise zum Strand. Unvermeidlich bleibt es, unser sehr sorgsam und kompliziert im Internet gebuchtes Hotel war über London am billigsten (kein Strohdach bitte – Gekriech und Gefleuch), es ist elf Kilometer weg,. Endlos geht es an Strandbauten vorbei, meist improvisierte Hütten, hier und da was Festeres, das hier war mal Hippieland, bevor alle Welt es entdeckte, allen voran die New Yorker Modeclique, die hier zu dreifachen Preisen zwischen Weihnachten und Sylvester fein und teuer die Sau raus lassen soll.
Immerhin ist hier wie dort eine Goldquelle in der Nähe, das merkt man, in Palenque sind es die hinreißenden Dschungel-Ruinen, hier der Strand, der Strand von Tulum ist der beste in ganz Mexiko (?!). Jedenfalls sind die Taxifahrer sich einig im Kassieren der viel zu hohen Pauschalpreise zum Strand. Unvermeidlich bleibt es, unser sehr sorgsam und kompliziert im Internet gebuchtes Hotel war über London am billigsten (kein Strohdach bitte – Gekriech und Gefleuch), es ist elf Kilometer weg,. Endlos geht es an Strandbauten vorbei, meist improvisierte Hütten, hier und da was Festeres, das hier war mal Hippieland, bevor alle Welt es entdeckte, allen voran die New Yorker Modeclique, die hier zu dreifachen Preisen zwischen Weihnachten und Sylvester fein und teuer die Sau raus lassen soll.
 Bei Ankunft sehr erlöstes Aufatmen, ‚Las Ranitas‘ ist eines der besten Häuser am Strand. Jetzt wirkt aufs Beste mein Spezialtrick, den ich nur hier und nur einmal verrate: wie bei jedem Hotel vorher habe ich zwei Tage vor Ankunft eine Mail geschickt, mit einem dramatischen Schneefoto aus Berlin und dem Text, dass wir nun bald da sind und allerbestes erwarten. Das soll herausheben aus der Masse der Internet-Bucher, das erlaubt auch das Buchen zum Super-Sonder-Schleuderpreis, die Mail gibt uns ein Gesicht, wir sind nicht mehr nur Buchungsnummer, haben einen Namen. Und wirklich, ‚wir haben Sie upgegradet, ist sowieso nicht viel los‘. Das an sich schon teure Zimmer wird zu einer ‚Combo‘ in der ersten Etage direkt am Strand, ‚Combo‘ das ist eine Suite.
Bei Ankunft sehr erlöstes Aufatmen, ‚Las Ranitas‘ ist eines der besten Häuser am Strand. Jetzt wirkt aufs Beste mein Spezialtrick, den ich nur hier und nur einmal verrate: wie bei jedem Hotel vorher habe ich zwei Tage vor Ankunft eine Mail geschickt, mit einem dramatischen Schneefoto aus Berlin und dem Text, dass wir nun bald da sind und allerbestes erwarten. Das soll herausheben aus der Masse der Internet-Bucher, das erlaubt auch das Buchen zum Super-Sonder-Schleuderpreis, die Mail gibt uns ein Gesicht, wir sind nicht mehr nur Buchungsnummer, haben einen Namen. Und wirklich, ‚wir haben Sie upgegradet, ist sowieso nicht viel los‘. Das an sich schon teure Zimmer wird zu einer ‚Combo‘ in der ersten Etage direkt am Strand, ‚Combo‘ das ist eine Suite.
 Riesenbalkon, pünktlich zum Einchecken erfolgt der alltägliche dramatische Sonnenuntergang. Wir bleiben vier Nächte nur, leider hatten Bedenken vor diesem Hippie-Paradies mit Küchenschaben (in unseren Befürchtungen) zu verkürzter Buchung geführt. Vermutlich hätten wir dieses pompöse Upgrading auch nicht bekommen, wenn wir die ganzen restlichen 9 Tage geblieben wären.
Riesenbalkon, pünktlich zum Einchecken erfolgt der alltägliche dramatische Sonnenuntergang. Wir bleiben vier Nächte nur, leider hatten Bedenken vor diesem Hippie-Paradies mit Küchenschaben (in unseren Befürchtungen) zu verkürzter Buchung geführt. Vermutlich hätten wir dieses pompöse Upgrading auch nicht bekommen, wenn wir die ganzen restlichen 9 Tage geblieben wären.
Morgens, nach dem Frühstück an den Strand, der ist schön gefegt, die kreisrunden Liegematratzen frisch bezogen, das Wasser piwarm, die Wellen körperfreundlich. Schon nach Minuten liegt Sie unten mit Büchern und Kissen aufgebaut unter der Palme. Er steht auf dem Balkon und sieht genau, was sich nähert, es wird den Genuss nicht verderben.
 Eine volle Besetzung robbt sich da ran, mit Models und Sonnenblenden, mit Schminkkoffern, Fotolampen und Klappstühlen, Basecaps und wichtigem Gemurmel in Walky Talkys: eine Fotocrew zur Erstellung von Modeaufnahmen, Bademoden für Harpers Bazar New York, wie wir später erfahren.
Eine volle Besetzung robbt sich da ran, mit Models und Sonnenblenden, mit Schminkkoffern, Fotolampen und Klappstühlen, Basecaps und wichtigem Gemurmel in Walky Talkys: eine Fotocrew zur Erstellung von Modeaufnahmen, Bademoden für Harpers Bazar New York, wie wir später erfahren.
Beim Lunch sind diese Berufs-Jugendlichen dann ein wenig zu laut, zu demonstrativ heiter, ihnen gehört die Welt, meinen sie, dass soll jeder merken, besonders sie selbst.
Nach zwei Tagen sind sie weg, wir nicht. Ohnehin bewegen wir uns so gut wie gar nicht mehr vom Fleck. Versuche woanders zu essen haben sich nicht bewährt, hier her kommen wegen der feinen Fischküche selbst Leute aus dem fernen Cancun, wir bleiben und tun nichts.  Abends ein paar Schritte am Strand, ein paar Minuten auf der Liege im Mondlicht, die Palmen rauschen, windig. Nicht ohne Groll fällt mir ein, wie einer in der FAZ Sonntagsausgabe geschrieben hat, die Mexikaner, die ja ‚ohnehin ein libidinöses Verhältnis zur Gewalt haben‘, hätten nun auch die Idyll Tulum auf dem Gewissen, zu viel Polizei, Südseefeeling in einem Polizeistaat, so was. Alles kann stimmen, nur das mit dem ‚libidinösen Verhältnis zur Gewalt‘ aus der Feder eines deutschen Nachwuchsschreibers, das scheint mir unsäglich und falsch. Bei dem vielen Gerede über die Macht der Drogenkartelle im Verbund mit korrupter Politik ist man froh über jeden Bullen, das hätte ich auch nicht erwartet. ‚Der Mexikaner‘ (gibt es den ?) jedenfalls ist harmoniefähiger und friedlicher als mancher Europäer.
Abends ein paar Schritte am Strand, ein paar Minuten auf der Liege im Mondlicht, die Palmen rauschen, windig. Nicht ohne Groll fällt mir ein, wie einer in der FAZ Sonntagsausgabe geschrieben hat, die Mexikaner, die ja ‚ohnehin ein libidinöses Verhältnis zur Gewalt haben‘, hätten nun auch die Idyll Tulum auf dem Gewissen, zu viel Polizei, Südseefeeling in einem Polizeistaat, so was. Alles kann stimmen, nur das mit dem ‚libidinösen Verhältnis zur Gewalt‘ aus der Feder eines deutschen Nachwuchsschreibers, das scheint mir unsäglich und falsch. Bei dem vielen Gerede über die Macht der Drogenkartelle im Verbund mit korrupter Politik ist man froh über jeden Bullen, das hätte ich auch nicht erwartet. ‚Der Mexikaner‘ (gibt es den ?) jedenfalls ist harmoniefähiger und friedlicher als mancher Europäer.
Unser Newsletter für Reiseverrückte
Du interessierst dich für Mexiko und willst keine Insider Tipps und neue Trendreiseziele mehr verpassen? Dann melde dich für unseren Newsletter an!
Wir informieren dich über neue Angebote, aktuelle Veranstaltungen und neue Blogbeiträge über unsere Lieblingsziele in Mexiko.